- Die Aufnahme des Oktoberdiploms in der Öffentlichkeit
- Arbeiten zur Umsetzung des Oktoberdiploms
- a) Bestimmungen für das ganze Reich
- b) Bestimmungen für Ländergruppen oder für einzelne Länder
- Vertrauensmänner und Landtagswahlordnungen
- Landesstatute
- Selfgovernment
- Aufbau der neuen Verwaltung in den Ländern der Stephanskrone
- Territorialfragen
- Die Nationalitäten- und die Sprachenfrage
- Das sogenannte Scheitern des Oktoberdiploms – Von Gołuchowski zu Schmerling
- Von Rechberg zu Erzherzog Rainer
- Weitere Themen – Pressepolitik – Protestantenpatent für Cisleithanien
Die Aufnahme des Oktoberdiploms in der Öffentlichkeit - Retrodigitalisat (PDF)
Die erste Seite des liberalen Wiener Blattes „Die Presse“ vom 23. Oktober 1860, es war ein Dienstag, berichtete unter anderem über das soeben erschienene Oktoberdiplom, über die Reise des Kaisers nach Warschau und über die Plebiszite in Neapel. Das Blatt vereinigte damit wie ein Hohlspiegel scheinbar auseinander liegende Nachrichten, die zusammen und in ihrer Gleichzeitigkeit gesehen ein klares Bild vom Zustand des Kaisertums Österreich zeichneten. Es ging darum, nach einer militärischen Niederlage alle Anstrengungen zu unternehmen, innen- und außenpolitisch wieder Tritt zu fassen.
Der Leitartikel war überschrieben mit „Das kaiserliche Diplom vom 20. Oktober“ und pries in hohen Tönen das am Samstag davor unterzeichnete, am Sonntag in der amtlichen Wiener Zeitung publizierte Staatsgrundgesetz. „Österreich besitzt eine Verfassung“, jubelte das Blatt und stellte fest, daß die befürchtete Bevorzugung eines Reichsteiles, gemeint war Ungarn, nicht eingetreten sei. Jene große Partei, das waren die Deutschliberalen, deren Ziel „eine einheitliche Entwicklung des Gesamtstaates unter freien Institutionen und bei gleicher Berechtigung Aller“ sei, brauche nun nicht mehr besorgt zu sein. Zwar seien die Landesordnungen noch nicht bekannt, doch könne man der Regierung nun vertrauen, daß dieselben den Grundsätzen der neuen Verfassung entsprechen würden. Der Leitartikel war flankiert von Telegrammen aus Linz, Troppau, Agram, Pest und Triest, die alle über die günstige, freudige, ja jubelnde Aufnahme der kaiserlichen Erlässe berichteten, einschließlich festlicher Stadtbeleuchtungen, Festtheater und Te Deum. Nur aus Pest wurde die Einschränkung berichtet, daß das Manifest zwar bei den gebildeten Schichten freudige Aufnahme gefunden habe, daß aber „die Massen […] davon noch zu wenig Kenntnis erlangt“ hätten.
Unter den Telegrammen fanden sich auch zwei aus Warschau mit der Nachricht, daß Se. Majestät der Kaiser von Österreich am Montag am Nachmittag in der Stadt eingetroffen und von Zar Alexander von Rußland vom Bahnhof abgeholt worden sei. Im Konvoi || S. 10 PDF || befanden sich nicht nur der russische Thronfolger, sondern auch der preußische Prinzregent und die preußischen Prinzen.
Schließlich findet sich auf derselben Seite noch ein Zweizeilen-Telegramm: „Neapel (ohne Datum). In zwanzig Provinzen hat fast Alles für die Annexion gestimmt“.
Das letztgenannte Telegramm erinnerte den kundigen Leser an die Ursache der prekären Lage der Monarchie. Die Niederlage im Feldzug gegen Sardinien-Piemont und Frankreich im Jahre 1859 hatte den weitgehenden Rückzug Österreichs aus Italien erzwungen und ein ungeahntes Erstarken der italienischen Einigungsbewegung ermöglicht. Diese hatte nach den Plebisziten in Nord- und Mittelitalien vom Frühjahr 1860 durch die singuläre Aktion des Zugs der Tausend unter Giuseppe Garibaldi eine Fortsetzung im Süden gefunden, und eben an dem Tag, an dem in Wien das Oktoberdiplom publiziert wurde, begannen im Königreich beider Sizilien die Volksabstimmungen für den Anschluß an das Königreich Viktor Emanuels II. Die innere Schwäche und die äußere Isolierung machten es Österreich unmöglich, diesen bedeutenden Staatsbildungsprozeß in seinem alten Herrschaftsgebiet zu verhindern.
Mit der Einberufung des verstärkten Reichrates und mit der Erlassung des Oktoberdiploms als Antwort auf dessen Beratungen schien es dem Kaiser und der Regierung immerhin gelungen zu sein, die überfällige innere Erneuerung und Konsolidierung anzubahnen. Gleichzeitig hatte Außenminister Johann Bernhard Graf v. Rechberg und Rothenlöwen begonnen, Österreich aus der äußeren Isolierung zu führen. Im Sommer hatte sich der Kaiser zweimal mit dem preußischen Prinzregenten Wilhelm getroffen, in Baden-Baden und in Teplitz, und je einmal mit König Johann von Sachsen und König Maximilian II. von Bayern1. Rechberg bemühte sich, Großbritannien in Handelsfragen entgegenzukommen. Er lege unter den gegenwärtigen Konjunkturen den größten Wert auf die Gewinnung der englischen Allianz, hatte er in der Ministerkonferenz gesagt2. Ein deutliches Zeichen und Höhepunkt dieser Politik sollte die Konferenz von Warschau mit dem russischen Zaren und dem preußischen Prinzregenten sein3.
Die Tage in Warschau waren nicht ohne Hoffnung. Bei der Abreise war der Kaiser auf der Fahrt zwischen Schönbrunn und dem Nordbahnhof von einer begeisterten Menge verabschiedet worden. In Ungarn ließ Generalgouverneur Ludwig Ritter v. Benedek Plakate anbringen, in denen es hieß: „Die Wünsche des Landes sind erfüllt, verfassungsmäßige und gesetzliche Zustände sind wiederhergestellt.“4 Ein Durchbruch im Inneren und gute äußere Kontakte schienen so manche bittere Erfahrung der letzten Jahre vergessen zu machen. Mit freiem Rücken im eigenen Haus und mit einer erneuerten konservativen Allianz ließ sich vielleicht doch das italienische Blatt wenden oder zumindest die französisch-sardinische Achse schwächen.
|| S. 11 PDF || In der Tat waren die Nachrichten aus der Heimat nicht schlecht. Ein Konvolut mit Telegrammen und Briefen an Rechberg über die Aufnahme des Diploms und über die Stimmung im Lande geben davon Zeugnis. Es handelt sich um die Korrespondenz mit Außenminister Rechberg in Warschau, wohin er den Kaiser begleitete5. Aus diesen Texten geht die große Anspannung hervor, in der sich die ungarischen Altkonservativen befanden, und die Erleichterung über jede halbwegs positive Nachricht. So schrieb Emil Graf Dessewffy aus Pest an Anton Graf Szécsen in Wien, er habe eine „ruhig überlegende, durch das Nichterwartete überraschte, im Ganzen nicht schlechte Stimmung“ gefunden. Szécsen beeilte sich, die Nachricht nach Warschau weiterzuleiten. In einem ausführlicheren Bericht schrieb Dessewffy, die Wiederherstellung der Verfassung erzeuge in Pest eine überwältigende Orientierungslosigkeit. „In den zwölf Jahren hat sich die separatistische Idee, der Haß gegen Österreich festgesetzt. Das läßt sich nicht in einem Tag kurieren.“ Jetzt sei vor allem die Verbesserung der auswärtigen Verhältnisse notwendig. Bald werde man fragen: „Was ist Teplitz? Was ist Warschau?“ Im Inneren aber sei notwendig „gutes Regieren und ein konsequentes und im Sinne des Umschwungs fortgehendes Verfahren in bezug auf die nichtungarischen Länder“. Über Ferencz Deák schrieb Dessewffy: „Mit Deák habe ich ungestört nicht sprechen können bis jetzt. Bis jetzt weiß ich das Eine: gegen die Sache agitieren wird er nicht. Was er darüber eigentlich denkt, weiß ich nicht, aber ich werde es erfahren.“ Vom neu ernannten Hofkanzler Nikolaus Freiherr Vay v. Vaya berichtete Szécsen an Rechberg, daß sich dieser gar keine Illusionen über die Schwierigkeiten mache, aber ruhig und entschlossen sei und nicht an der Möglichkeit zweifle, sie zu überwinden.
Das Konvolut enthält auch Nachrichten über verschiedene Festlichkeiten. Aus vielen Städten wurden „Stadtbeleuchtungen“ gemeldet, d. h. die Bewohner erleuchteten am Abend aus eigenem oder aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses ihre Fenster, eine einfache und beliebte Möglichkeit, Festesfreude zum Ausdruck zu bringen. Solche Illuminationen wurden u. a. aus Graz, Agram, Ödenburg, Preßburg und Triest berichtet.
Schon am 23. Oktober 1860 begannen sich einzelne Töne von Enttäuschung beizumischen. In Prag wurde die Stadtbeleuchtung wieder abgeblasen. In Buda und in Pest sollte am Abend beleuchtet werden, das wurde Anlaß zu „Exzessen“. Junge Leute zogen durch die Straßen und warfen beleuchtete Fenster ein. Das Militär schritt ein, einige wurden verhaftet, einige verwundet, einer erlag sogar den Verletzungen. Szécsen versuchte zu beruhigen und telegrafierte nach Warschau: „Baron Vay hat zustimmende, befriedigende Briefe aus allen Teilen Ungarns, namentlich beachtenswert aus Debreczin. Exzesse in Pest Folge der Desorientierung und moralischen Deroute der revolutionären Partei, welche alles in Bewegung setzen wird, um ihr Terrain wieder zu gewinnen […].“6 Es gab auch das Gegenteil: in Triest wurden unbeleuchtete Fenster eingeschlagen.
Die Stimmung veränderte sich von begeistert zu abwartend. Die Slawen und Rumänen bemerkten die Zugeständnisse an die ungarische Sprache, die Serben und Rumänen waren enttäuscht über die angekündigte Angliederung der serbischen Woiwodschaft an Ungarn, || S. 12 PDF || die Demokraten in Prag waren mißmutig, die Deutschen entdeckten die großen Zugeständnisse an die Ungarn. „Ungarns Sonderstellung erregt Unbehagen“, hieß es aus Graz. In Brünn folgerte man aus den „außerordentlichen Zugeständnissen an die Ungarn, daß die Landesstatute der deutsch-slawischen Länder, liberal gehalten, sehr befriedigen werden“. In Prag verbreitete sich die Ansicht, daß Ungarn vorzüglich gewonnen habe. Nicht ohne Grund hatte Dessewffy von der Notwendigkeit gesprochen, den nichtungarischen Ländern gegenüber eine „im Sinne des Umschwungs“ konsequente Politik zu betreiben.
Am 26. Oktober traf der Kaiser wieder in Wien ein. Die Gespräche in Warschau waren nicht nach Wunsch verlaufen. Es war zu keiner Neuauflage der Heiligen Allianz gegen die revolutionären Kräfte gekommen. Österreich konnte zwar mit der Unterstützung Preußens und Rußlands im Fall eines Angriffs durch Sardinien rechnen, nicht aber mit der Unterstützung zur Wiedererlangung der früheren österreichischen Stellung in Italien. Der Öffentlichkeit gegenüber war ohnehin nur die Verbesserung der persönlichen Atmosphäre als Ziel der Zusammenkunft herausgestellt worden. „Die Presse“ kommentierte das Ergebnis lakonisch mit dem Satz: „Die Lage ist na ch Warschau, was sie vor Warschau war.“ Weder die antirevolutionären Hoffnungen der „Kreuzritter und Ultramontanisten“, noch die Erwartungen der „Gemäßigten“, die mit einem starken Signal gegenüber Frankreich und Sardinien zufrieden gewesen wären, seien erfüllt worden. Aber auch Frankreichs Idee eines europäischen Kongresses zur Lösung der italienischen und sonstiger Fragen sei nicht aufgegriffen worden7.
Inzwischen war in der Wiener Zeitung vom 24. Oktober das Landesstatut für die Steiermark publiziert worden, als erstes der vier bereits vom Kaiser genehmigten Statute. Die neue konservative Zeitung „Das Vaterland“ meinte in einem ersten Kommentar, die Gegner des ständischen Prinzips müßten wohl zufrieden sein mit der neuen Landesvertretung angesichts der starken Berücksichtigung des Mittelstandes, eher könnte der Großgrundbesitz wegen Benachteiligung Bedenken haben8. In der Tat stellte „Die Presse“ fest, daß zwar leider das ständische Prinzip beibehalten worden sei, daß aber doch die Zusammensetzung wesentlich anders sei als früher und daß die Abgeordneten nach dem neuen Statut „schon das Bild einer wahren Repräsentanz ergeben könnten“. Zugleich sah „Die Presse“ sofort, „daß der steiermärkische Landtag sich daher in weit engeren Grenzen zu bewegen hat, als dies in dem ungarischen Landtage der Fall zu sein scheint“9. In der „Ost-Deutschen Post“ kritisierte Ignaz Kuranda, daß das Statut statt der erhofften Interessenvertretung doch wieder eine ständische Vertretung bringe, ebenso daß die Landtagsabgeordneten Gemeinderäte sein müßten10. Mit jeder neuen Landesordnung vergrößerte sich die Enttäuschung bei den Deutschliberalen. Am 27. Oktober erschien das Landesstatut für Kärnten in der Wiener Zeitung. Ein paar Tage später schrieb „Die Presse“, es gehe ihr vor allem um den Reichsrat, die Landtage würden sie nur interessieren als Wahlkörper für diesen. Nun kam die Kritik: „Wir vermögen uns nicht zu denken, || S. 13 PDF || daß in Niederösterreich ein Wahlgesetz mit streng ständischen Grundlagen angewendet werden wird, während die Ungarn für ihre Landtagswahlen nahezu das allgemeine Stimmrecht erhalten. […] Und warum soll überhaupt der Bürger von Wien des wichtigsten politischen Rechts, des Wahlrechts beraubt sein, das ein ganz gleichsituierter Bürger in Kecskemet ausüben darf? Soll es in der Tat dahin kommen, daß die Österreicher nach Ungarn einwandern müssen, um politisch mündig zu werden?“11 Am 1. November folgte das Statut für Salzburg. „Der Inhalt desselben hat unsere Erwartungen abermals um einige Grade niedriger gestimmt und uns in unseren Hoffnungen kühler gemacht“, schrieb „Die Presse“12. Viel radikaler als im Kommentar zum steiermärkischen Statut fand sie nun, das doppelt indirekte Wahlsystem sei „mit wahrer Repräsentation ganz unvereinbar“. Am 13. November wurde das Tiroler Statut publiziert. Tags darauf schrieb „Die Presse“, dieses Statut widerlege alle jene, die aufgrund der Ablehnung der bisherigen Statute auf einen Wandel in der Regierung gehofft hatten (entsprechende Gerüchte kursierten bereits). Vielmehr sei im Tiroler Statut das klerikale und das adelige Element sogar noch stärker vertreten. Am 20. November erschien ein Artikel, der der Regierung vollends den Fehdehandschuh hinwarf. Die ungünstige Aufnahme der bisherigen vier Statute sei offenbar, die Stimmung sei so schlecht wie vor dem 20. Oktober, es bestehe ein „ungeheurer Abstand“ zwischen den ungarischen und den außerungarischen Provinzen, das sei ein schwerer Fehler. Am Ende forderte sie, wenn auch ohne den Namen zu nennen, die Ablöse des Staatsministers Agenor Graf Gołuchowskis. Offenbar sei der Gedanke der ungarischen Minister ein anderer als der des Redakteurs der Landesstatute. Die Angleichung des Rechts zwischen Ungarn und den übrigen Provinzen sei „nicht durch eine Verständigung unter den Ministern erreichbar, sondern nur durch einen Ministerwechsel. Die vier publizierten Landesstatute können nicht bleiben, wie sie sind.“13 So hatte sich also die Stimmung in wenigen Wochen verändert14. Am 29. November wurde das erstmals in der Ministerkonferenz offen ausgesprochen. Finanzminister Ignaz Edler v. Plener wies auf die „steigende Unzufriedenheit in den deutschen Ländern mit den ihnen gewährten politischen Institutionen“ hin.
In diesen Wochen stieg aber auch die Ablehnung des Oktoberdiploms in Ungarn an. Es begann jene immer heftiger werdende Bewegung in den Komitaten, die schließlich in der Steuerverweigerung ein für die altkonservativen Politiker und überhaupt für die Regierung überaus unangenehmes Instrument des Protestes fand. Auch hier war es der Finanzminister, der es erstmals in der Konferenz aussprach. Am 1. November sagte er, daß „neuesten Berichten aus Ungern zufolge, die Steuern dort sehr unregelmäßig eingehen, ja hin und wieder wirkliche Steuerverweigerung zu besorgen ist“15.
|| S. 14 PDF || Das Oktoberdiplom löste also eine kurze Begeisterung, in Ungarn wenigstens ein überraschtes Nachdenken aus. Nur zu bald aber folgten wachsende Enttäuschung und immer heftigere Ablehnung, sowohl bei der Mehrheit der politischen Akteure in Ungarn als auch in den „übrigen, nicht zur ungarischen Krone gehörenden Ländern“, wie es im Artikel III des Diploms hieß.
An der wachsenden Enttäuschung konnten auch kleine Gesten einer politischen Entspannung nichts ändern, wie sie von den Ministern angeregt oder befürwortet wurden und die den bisherigen Gegnern der Regierung galten. So wurden 17 in Josefstadt aus politischen Gründen Internierte freigelassen16. Nachdem Benedek eigenmächtig sämtliche Verwarnungen an Zeitungen annulliert hatte, wurden auch die Zeitungen außerhalb Ungarns amnestiert, und alle Verwarnungen wurden aufgehoben17. Schließlich wurden auch jene Untersuchungen und Prozesse wegen Majestätsbeleidigung eingestellt bzw. niedergeschlagen, wo der Tatbestand nur darin bestanden hatte, eine Änderung des Regierungssystems zu verlangen, wie sie dann tatsächlich mit dem Diplom erfolgt war18.
Auch eine andere mehrfach beabsichtigte aber nicht durchgeführte Maßnahme hätte die Stimmung wohl nicht verbessert. Der Kaiser beauftragte am 13. November den Finanzminister, alle Beschwerden und Wünsche, die im Reichsrat vorgebracht worden waren, zu sammeln und in eine Übersicht zu bringen. Er wollte sie dann in der Art eines „Abschiedes“ erledigen19.
Es folgten spannungsgeladene Wochen, bis sich im Wiener Machtzentrum die Überzeugung von der Notwendigkeit eines neuerlichen teilweisen Kurswechsels Bahn brach. Diese Entwicklung ist bekannt und mehrfach geschildert worden. Bevor aber darauf eingegangen wird, müssen doch die vielfachen Wirkungen aufgezeigt werden, die die Entschließungen vom 20. Oktober im allgemeinen und z. T. ganz abseits der großen politischen Bühne zeitigten. Die Regierung begann sofort mit der Durchführung der Maßnahmen, die im Diplom und in den begleitenden Handschreiben angekündigt oder angeordnet waren.
Arbeiten zur Umsetzung des Oktoberdiploms - Retrodigitalisat (PDF)
Noch vor seiner Abreise nach Warschau am Abend des 21. Oktober 1860 berief der Kaiser seine Minister zu einer Sitzung und hielt eine „Ansprache“. Er forderte sie auf, nun die Entschließungen vom 20. Oktober „mit aller Tätigkeit und Energie zu vollziehen“. Er verwahrte sich gegen weitere Konzessionen und forderte die Minister zum Zusammenwirken auf. Beim „Vollzug“ müsse „vollkommene Einigkeit herrschen“20.
Beim Vollzug der Bestimmungen vom 20. Oktober ist zu unterscheiden zwischen den Bestimmungen, die für das ganze Reich gedacht waren, und jenen, die nur die Länder der ungarischen Krone oder einzelne von ihnen oder die „übrigen“ Länder oder einzelne von ihnen betrafen.
a) Bestimmungen für das ganze Reich
Aus dem Diplom selbst folgten vier operative Aufgaben, die das ganze Reich bzw. alle Länder betrafen, nämlich die Einberufung der Landtage und des Reichsrates (Artikel I), die Hinterlegung des Diploms in den Landesarchiven und seine Publikation in den Ländern (Artikel IV).
Die ersten beiden Aufgaben waren die zentralen politischen Agenden der kommenden Monate. Weil die Mitglieder des Reichsrates nach Artikel I des Diploms von den Landtagen zu entsenden waren, mußten zuerst die Landtage vorbereitet und einberufen werden. Als erster konnte am 14. Februar 1861 der ungarische Landtag auf den 2. April einberufen werden21. Am 21. Februar wurde die Ermächtigung zur Einberufung des kroatisch-slawonischen Landtags erteilt, er trat am 15. April zusammen22. Am 26. Februar 1861 wurden die Landtage der deutsch-slawischen Kronländer mit inzwischen geänderten Spielregeln23 auf den 6. April einberufen24. Nur die Einberufung des siebenbürgischen Landtags verzögerte sich. Zwar unterzeichnete der Kaiser im September 1861 das Einberufungsreskript, es wurde aber zurückgezogen. Erst am 21. April 1863 wurde der Landtag auf den 1. Juli einberufen25. Daß der ungarische und der kroatische Landtag bald wieder aufgelöst wurden, daß die cisleithanischen Landtage mit dem Februarpatent andere Spielregeln erhalten hatten, daß es in Siebenbürgen so lange dauerte, daß schließlich der Reichsrat nicht von allen Ländern beschickt wurde, all das steht auf einem anderen Blatt. Der Wille und daraus abgeleitet die gesetzliche Notwendigkeit, die Landtage einzuberufen, waren im Oktoberdiplom ausgesprochen und grundgelegt. Dasselbe galt für den Reichsrat, der, ebenfalls mit geänderten Spielregeln, am 26. Februar 1861 auf den 29. April einberufen wurde26.
Die Hinterlegung des Oktoberdiploms in den Landesarchiven wurde einmal in der Ministerkonferenz besprochen27 und in der ersten Sitzung der Landtage durchgeführt, indem jeweils der Vertreter der Regierung, in der Regel der Statthalter, das Dokument dem Vorsitzenden des Landtages unter Berufung auf Artikel IV überreichte28. || S. 16 PDF || Die Publikation in den Ländern – der Halbsatz sprach wörtlich von „Eintragung in die Landesgesetze“, eine der „unklaren“ Stellen des Diploms (Tezner29) – wurde vollzogen30.
Das ganze Reich betrafen auch die ersten beiden begleitenden Handschreiben. Sie waren an den Ministerpräsidenten gerichtet. Das eine befahl die Ausarbeitung eines neuen, organischen Reichsratsstatutes. Bereits in der Konferenz am 27. Oktober 1860 und noch einmal im Beisein des Kaisers am 28. Oktober wurden mit dieser Ausarbeitung die Minister Graf Szécsen und Joseph Lasser Ritter v. Zollheim beauftragt31. Allerdings legten sie nie einen Entwurf vor. Erst am 9. Februar 1861 trat der neue Staatsminister Anton Ritter v. Schmerling unter geänderten politischen Verhältnissen mit dem Entwurf eines Statuts für die Reichsvertretung vor den Ministerrat, aus dem schließlich das Grundgesetz über die Reichsvertretung als Beilage zum Februarpatent hervorging32.
Das zweite begleitende Handschreiben betraf die Zentralstellen bzw. die Zusammensetzung der Regierung und insofern auch das ganze Reich. Das Wesen der Umstrukturierung war die Gliederung der inneren Verwaltung nach Ländern, statt wie bisher zentral und thematisch. Die Ministerien des Inneren sowie des Kultus und Unterrichts wurden als allgemeine Reichsbehörden aufgehoben, an ihre Stelle traten die ungarische und die siebenbürgische Hofkanzlei bzw. für „die anderen“ Länder das Staatsministerium. Es war ein großer Schritt in Richtung Dualismus, aber noch kein voller Dualismus, weil die Verwaltung dieser Agenden für die ungarischen Länder nicht einer Person allein, dem ungarischen Hofkanzler, sondern drei Personen zugewiesen war. Siebenbürgen blieb ja selbständig, und Kroatien-Slawonien ressortierte vorläufig zum Staatsministerium33. Außerdem waren für das ganze Reich vorgesehen ein „Rat des öffentlichen Unterrichtes“ und ein Handelsminister, allerdings beide mit unklarem „nicht eigentlich administrativen“ Wirkungsbereich. || S. 17 PDF || Auch das Justizministerium wurde als allgemeine Reichsbehörde aufgelöst. Die Justizangelegenheiten sollten im Ministerrat34 für das Königreich Ungarn durch den Hofkanzler auf Grundlage der Anträge des wieder einzusetzenden Judex Curiae, für die übrigen Länder (hier waren Siebenbürgen und Kroatien-Slawonien inbegriffen) durch den Präsidenten eines neu zu schaffenden Kassationshofes in Wien vertreten werden, also auch hier kein klarer Dualismus.
Einige der Bestimmungen des zweiten Handschreibens waren bereits durch die am 20. Oktober getroffenen Personalentscheidungen in die Wege geleitet35. Andere wurden in den kommenden Wochen und Monaten, einige gar nicht vollzogen.
Bereits am 29. Oktober 1860 wurde die Festsetzung des Wirkungskreises von Unterrichtsrat und Handelsministerium und die Ernennung des siebenbürgischen Hofkanzlers auf die Tagesordnung gesetzt36. Die Teilung der Unterrichtsagenden rief heftigen Widerstand seitens der Ministerialbürokratie hervor, was mehr als einmal die Konferenz beschäftigte37. Die theoretisch-didaktischen Angelegenheiten sollten dem Unterrichtsrat, die administrativen dem Staatsministerium bzw. den Hofkanzleien zufallen. Unterstaatssekretär Joseph Alexander Freiherr v. Helfert, am 20. Oktober mit der einstweiligen Leitung des Ministeriums bis zum Vollzug der Aufhebung betraut38, setzte erfolgreich alle Hebel in Bewegung, um die didaktisch-administrative Trennung zu hintertreiben. So wurde der Unterrichtsrat erst 1863 errichtet39, blieb aber auch dann eine Totgeburt. 1867 wurde das Ministerium für Kultus- und Unterricht in Cis- und in Transleithanien wieder hergestellt. Helfert verweigerte auch die Herausgabe von Akten an die ungarische Hofkanzlei. In dieser Sache mußte er natürlich nachgeben40.
Auch die Ernennung eines Handelsministers verzögerte sich. Erst mit dem Regierungswechsel am 4. Februar 1861 wurde Matthias Konstantin Capello Graf v. Wickenburg zum Minister für Handel- und Volkswirtschaft ernannt. Der Wirkungskreis des Ministeriums blieb umstritten41.
Die Ernennung des siebenbürgischen Hofkanzlers wurde am 29. Oktober und am 24. November 1860 besprochen42. Bemerkenswerterweise war es der ungarische Hofkanzler, der einen Vorschlag machte. Die Ungarn waren ja gegen die Errichtung der siebenbürgischen Hofkanzlei eingetreten, weil sie die von ihnen erwünschte Union Siebenbürgens || S. 18 PDF || mit Ungarn präjudizierte43, da sich aber der Kaiser dafür entschieden hatte, wollten sie wenigsten auf die Wahl der Person Einfluß nehmen. Vays Vorschlag wurde angenommen. Mit Franz Freiherr v. Kemény waren zwar die Ungarn und Szekler, nicht aber die Rumänen und die Deutschen zufrieden. Im übrigen wurde er nicht zum Hofkanzler, sondern nur zum provisorischen Präsidenten der siebenbürgischen Hofkanzlei ernannt, ein feiner Unterschied, mit dem den Gefühlen der Ungarn entgegengekommen wurde44.
Bei der Neuregelung der obersten Justizverwaltung gab es Schwierigkeiten. Die Ernennung des ungarischen Judex Curiae verzögerte sich. Der ungarische Hofkanzler schlug am 18. November 1860 die Ernennung Georg Graf Apponyis vor, der zum engsten Kreis der altkonservativen Gruppe im verstärkten Reichsrat gehört hatte. Der Kaiser ernannte aber den an zweiter Stelle gereihten Johann Graf Cziráky. Erst als dieser unannehmbare Bedingungen stellte, wurde Apponyi am 7. Jänner 1861 ernannt und begann mit der Organisierung der Septemviral- und der königlichen Tafel45. Die Bestimmung, die Justizverwaltung für die „übrigen Länder“ auch einem Gerichtshof zu übertragen, parallel zu Ungarn, nämlich einem neu zu schaffenden Kassationshof, stieß auf großen Widerstand46. Es wurde die Beibehaltung bzw. offizielle Wiedererrichtung des Justizministeriums gefordert. Dagegen wandte Szécsen ein, dies sei ein Abgehen vom 20. Oktober und würde in Ungarn auch den Ruf nach einem Ministerium hervorrufen, wie 1848. Als Lösung blieb ein Provisorium. Das eigentlich aufgelöste Justizministerium blieb provisorisch bestehen und wurde interimistisch von Lasser geleitet. Am 4. Februar 1861 wurde er von Adolph Freiherr v. Pratobevera abgelöst, der aber auch nicht zum Justizminister, sondern zum Minister ernannt und mit der Leitung des Justizministeriums betraut wurde.
Neben den eigentlichen begleitenden Handschreiben, die dispositive Anordnungen enthielten, gab es am 20. Oktober noch die Handschreiben, mit denen Personen abberufen oder ernannt wurden, also die Regierung umgebildet wurde47. Eines dieser Handschreiben verfügte, gleichsam beiläufig, die Umwandlung des Armeeoberkommandos in das Kriegsministerium. Das war weit mehr als eine Namensänderung, vielmehr die Erfüllung des dringenden Wunsches nach Einbeziehung der Armeefinanzierung in die Verantwortung des Ministerrates. Zugleich wurde Erzherzog Wilhelm als Armeeoberkommandant enthoben und mit August Franz Joseph Christoph Graf v. Degenfeld-Schonburg wieder ein Kriegsminister ernannt. Er war selbstverständlich für das ganze Reich zuständig.
b) Bestimmungen für Ländergruppen oder für einzelne Länder
Alle übrigen Handschreiben betrafen nicht das ganze Reich, sondern Ländergruppen oder einzelne Länder. Daher richteten sich diese Handschreiben an die obersten Räte des Kaisers bzw. Königs für die jeweiligen Länder, also an den ungarischen Hofkanzler für || S. 19 PDF || Ungarn (6 Handschreiben), an den Staatsminister für die „übrigen“ Länder (2), an den Banus betreffend Kroatien-Slawonien (1), stellvertretend an den Ministerpräsidenten für Siebenbürgen (1), weil der siebenbürgische Hofkanzler noch nicht ernannt war, und ebenfalls stellvertretend an den Ministerpräsidenten betreffend die serbische Woiwodschaft (1), die ja wieder an Ungarn angegliedert werden sollte.
Um das Oktoberdiplom oder besser gesagt die Bestimmungen vom 20. Oktober 1860 richtig zu beurteilen, müssen diese Handschreiben untersucht werden, und es ist ihr Vollzug zu verfolgen. Das ist eben der Inhalt der Protokolle des Ministerrates des vorliegenden Bandes. Manches wurde zwar einfach im Weg der Vortragserstattung und der darauf folgenden Ah. Entschließung geregelt, vieles war aber doch im Schoß der Regierung zu besprechen, vieles erwies sich als kontroversiell. Zusammengefaßt ging es um folgende Themen: Festlegung der Landtagswahlordnungen und der ausständigen Landesstatute als notwendige Vorbereitung zur Einberufung der Landtage; Fortsetzung der Arbeiten zur Durchführung des Selfgovernments im Sinn des Ministerprogramms vom 21. August 1859 48 (Gemeindeordnungen, Gutsgebiete, Kreise, Bezirke); Aufbau der neuen Verwaltung in den Ländern der Stephanskrone; Regelung von Territorialfragen, die sich aus der Wiederherstellung der früheren Verfassungen in diesen Ländern ergaben; Berücksichtigung von Anliegen der Nationalitäten und Sprachenfrage.
Der folgende Überblick ist nach diesen inhaltlichen Gesichtspunkten gegliedert. Alle diese Prozesse verliefen gleichzeitig und waren z. T. ineinander verschränkt. Eine rein chronologische Betrachtungsweise würde dem Umsetzungsprozeß nicht gerecht, daher müssen die einzelnen Themenbereiche getrennt behandelt werden, wobei die eine oder andere Wiederholung und ein zeitliches Vor- und Zurückgehen in Kauf genommen werden muß. Der Wechsel von Gołuchowski zu Schmerling spielte je nach Thematik eine größere oder kleinere Rolle, kann aber nicht als allgemeine Zäsur bewertet werden.
Vertrauensmänner und Landtagswahlordnungen - Retrodigitalisat (PDF)
Die große Schwierigkeit bei der Einberufung der Landtage bestand darin, daß es keinen gemeinsamen, anerkannten und gleichen Rechtsboden gab, auf den man hätte zurückkehren können. Die Unterschiede zwischen den Landtagen der Länder der ungarischen Krone, die in bezug auf die Gesetzgebung voll berechtigt waren, und den Landständen der cisleithanischen Länder, die kein Gesetzgebungsrecht gehabt hatten, waren zu groß. Dazu kam, daß die Aufhebung der Privilegierung des Adels und die Gleichheit vor dem Gesetz beibehalten wurde, was eine vollständige Rückkehr zum gesetzlichen Zustand vor der Revolution unmöglich machte. Die vollständige Rückkehr zu den ungarischen Aprilgesetzen des Jahres 1848 ging aber dem Kaiser, und deshalb auch den einen Ausgleich suchenden altkonservativen „Oktobermännern“ wieder zu weit, weil sie die volle Konstitutionalisierung bedeutet hätte. Für Cisleithanien hätte man die Landesordnungen || S. 20 PDF || nehmen können, die nach 1848 erlassen worden waren49. Aber abgesehen davon, daß sie nie in Wirksamkeit getreten waren, entsprachen sie nicht den Vorstellungen des Innenministers Gołuchowski und der konservativen Regierungsmehrheit. Das Oktoberdiplom selbst dekretierte einen neuen gemeinsamen Rechtsboden auf föderativer Grundlage. Um es aber praktisch umsetzen zu können, mußten in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Maßnahmen getroffen werden. Diesem Zweck dienten die begleitenden Handschreiben. Sie setzten eine komplizierte Maschinerie in Gang, um in allen Ländern Landtage zu ermöglichen. Außerdem stellte es sich heraus, daß man, um zum Ziel zu kommen, erst einen wesentlichen Bauteil (die vier schon verabschiedeten Landesstatute) und dazu den Maschinisten (Gołuchowski) austauschen mußte.
Für Ungarn wurde nicht „die Verfassung“ wiederhergestellt, sondern es wurden nur, wie es im Handschreiben an den Hofkanzler hieß, „die verfassungsmäßigen Institutionen wieder ins Leben gerufen“. Die Legislative des ungarischen Landtags wurde durch die Befugnisse des Reichsrates beschränkt, und es wurde eine provisorische Wahlordnung angekündigt, in der auch früher nicht wahlberechtigte Klassen vertreten sein würden. Die Vorbereitung einer solchen Wahlordnung wurde einer Versammlung von Vertrauensmännern aufgetragen, die unter dem Vorsitz des Kardinalprimas Johann Baptist Scitovsky v. Nagy-Kér in dessen Sitz in Gran zusammentreten sollte50. Sie hatte aus Männern zu bestehen, „die durch amtliche oder bürgerliche Stellung, Talent, geleistete öffentliche Dienste und öffentliches Vertrauen hervorragen“. Dieses Instrument wurde noch mehrfach eingesetzt, und verschiedenste derartige Versammlungen wurden, sofern sie zustande kamen, in den kommenden Wochen und Monaten zu einem Bindeglied zwischen der absolutistischen Zeit und der künftigen ordentlichen Landtagstätigkeit, gleichsam kleine Konstituanten von Kaisers bzw. Königs Gnaden.
Die Graner Konferenz, wie die Versammlung genannt wurde, sollte am 18. Dezember 1860 zusammentreten. Man wußte, daß sie vorschlagen würde, das 1848 erlassene Wahlgesetz anzuwenden. Wenige Tage zuvor, am 14. Dezember, hatten die Minister diskutiert, ob man angesichts der inzwischen eingetretenen Zustände im Lande die Konferenz überhaupt abhalten lassen solle und ob der vermutete Antrag für die Regierung annehmbar sei51. Das Protokoll der Ministerkonferenz, an der zum ersten Mal der neue Staatsminister Schmerling teilnahm, ist ein bemerkenswertes Dokument über die Lage in Ungarn. Der Hofkanzler sprach vom „offenen anarchischen Treiben“, dem man „mit Entschiedenheit und selbst durch Anwendung materieller Gewalt“ entgegentreten sollte. Es wurde sogar eingehend die Ausrufung des Belagerungszustandes erörtert. Die ungarischen Teilnehmer rieten dennoch dringend sowohl zur Abhaltung der Graner Versammlung als auch zur Annahme des 1848er Wahlgesetzes als Provisorium. Dieses Gesetz sei für die bürgerlichen Elemente und für den unadeligen Grundbesitz so wichtig, || S. 21 PDF || weil es „die Schranken eingerissen hat, welche die Volksklassen in Absicht auf politische Rechte bis dahin so strenge geschieden hatte“, und sie würden sich „beinahe frenetisch“ daran klammern. Die Konferenz wurde abgehalten, der Belagerungszustand mußte nicht ausgerufen werden. Das 1848er Wahlgesetz wurde nicht als solches reaktiviert, wohl aber wurde es der provisorischen Wahlordnung zugrunde gelegt.
Weniger dramatisch, dafür komplizierter gestalteten sich die Dinge in Kroatien-Slawonien. Dem Ban wurde angeordnet, eine Beratung mit Männern abzuhalten, „welche durch amtliche oder bürgerliche Stellung, Talent, geleistete öffentliche Dienste oder öffentliches Vertrauen hervorragen“52. Diese „Banalkonferenz“ genannte Versammlung trat schon am 26. November 1860, also noch vor der ungarischen Graner Konferenz zusammen. Auch sie schlug vor, das Wahlgesetz aus dem Jahr 1848 wieder anzuwenden. Das wurde genehmigt, und danach wurde der kroatisch-slawonische Landtag einberufen53. Die Banalkonferenz begnügte sich aber nicht damit, sondern setzte, wenn auch in Form von Bitten, grundsätzliche organisatorische und territoriale Fragen auf die Tagesordnung, die zu mehrfachen Beratungen in der Ministerkonferenz führten54. U. a. verlangte sie die Errichtung einer kroatisch-slawonischen Hofkanzlei und berührte damit vor allem das Verhältnis zwischen Kroatien und Ungarn. Die ungarischen Teilnehmer der Ministerkonferenz, die die Vereinigung Kroatiens mit Ungarn herbeiwünschten, sahen in einer solchen Hofkanzlei ein Präjudiz zugunsten der selbständigen Stellung Kroatiens. In der wiederholten Beratung im Beisein des Kaisers fanden die Ungarn eine knappe Mehrheit für ihren Standpunkt. Nur der neue Polizeiminister Carl Freiherr Mecséry de Tsóor und die Minister Lasser und Plener unterstützten den Banus. Hier wird bereits die Spaltung der Konferenz in einen konservativen proungarischen und einen deutschliberalen antiungarischen Flügel sichtbar. Der Kaiser entschied sich für einen Kompromiß, nämlich die Errichtung einer bloßen Hofkommission für Kroatien. Am Ende wurde daraus das kroatisch-slawonische Hofdikasterium. De jure hatten sich die Ungarn, de facto die Kroaten durchgesetzt. Ein Jahr später, als man mit der Errichtung des Provisoriums nicht mehr auf die Ungarn Rücksicht nehmen mußte, wurde das Hofdikasterium in eine Hofkanzlei umgewandelt55.
Die Banalkonferenz brachte noch eine andere Unionsfrage zur Sprache, nämlich das Verhältnisses zwischen Kroatien-Slawonien und Dalmatien. Darüber war weder im Oktoberdiplom noch in den begleitenden Handschreiben etwas gesagt. Die Frage berührte sowohl Ungarn als auch die politische Haltung der Slawen und der Italiener und wurde in der Konferenz ausführlich beraten, wobei in den Wortmeldungen der Minister einerseits || S. 22 PDF || eine gewissen Unsicherheit, andererseits schonungslose Offenheit zu sehen ist56. Rechberg war für die Union. Er sah in der Vereinigung eine Absicherung gegen allfällige italienischen Aspirationen. Die meisten Teilnehmer hatten Bedenken, vor allem sollte das Land selbst gehört werden. Mehrere Minister machten die Frage vom Verhältnis Kroatiens zu Ungarn abhängig. Sie fürchteten ein Übergewicht Ungarns, wenn Kroatien mit Ungarn vereinigt würde und dazu noch Dalmatien käme. Nur falls Kroatien selbständig bliebe, käme die Union Dalmatiens mit Kroatien für sie in Frage. Das Ergebnis der z. T. heftigen Diskussion war die Einladung und Beiziehung von Vertrauensmännern aus Dalmatien zur Banalkonferenz57. Wieder wurde also dieses Instrument bemüht, diesmal ganz ohne Erfolg. Zwar lud der Statthalter in Dalmatien, Lazarus Freiherr v. Mamula, selbst ein Gegner der Union, 21 Vertrauensmänner ein. Die meisten weigerten sich aber, nach Agram zu kommen. Vor allem die Italiener waren strikt gegen die Vereinigung58. Mamula berichtete, die Italiener sprächen von der gänzlichen Unmöglichkeit der Vereinigung und von den nachteiligen Folgen für den Gesamtstaat. Er selbst meinte, die Absichten der Befürworter würden gerade das Gegenteil der Regierungsinteressen bezwecken59. Mit dem Februarpatent erhielt Dalmatien eine Landesordnung, Artikel III des Patents sagte, daß die Frage der Stellung Dalmatiens zu Kroatien-Slawonien „noch nicht endgültig entschieden“ sei. Gemäß dem ungarisch-kroatischen Ausgleich von 1868 war Dalmatien de jure ein Teil Kroatiens, de facto aber blieb es bis zum Ende der Monarchie ein selbständiges, zu Cisleithanien gehöriges Kronland.
Schwierig waren auch die Verhältnisse in Siebenbürgen, wo drei Nationalitäten lebten. Die neuen Rechtsverhältnisse machten, wie es das betreffende Handschreiben an Rechberg formulierte, tiefgreifende Veränderungen an der früheren siebenbürgischen Verfassung notwendig60. Daher wurde dem (erst zu ernennenden) siebenbürgischen Hofkanzler aufgetragen, „eine Beratung mit Männern der verschiedenen Nationalitäten, Konfessionen und Stände einzuleiten“, um entsprechende Anträge über die Vertretung des Landes zu stellen. Kemény wurde am 9. Dezember 1860 ernannt. Seine Vorstellungen, die er informell schon vorher unterbreitet hatte, stießen in der Konferenz am 15. Dezember auf heftigen, vom neuen Staatsminister Schmerling angeführten Widerspruch61. Nur der Ort der Versammlung, Karlsburg, war außer Streit, nachdem Wien, Hermannstadt, Kronstadt und Klausenburg genannt aber offenbar verworfen worden waren. Kemény schlug vor, Siebenbürgen sofort nach dem Stand von 1847 zu reorganisieren, sonst könnten weder die Karlsburger Konferenz, wie sie nun genannt wurde, noch der Landtag arbeiten. Das rief einen Sturm der Entrüstung hervor. Schmerling, erst seit zwei || S. 23 PDF || Tagen im Amt, meinte scharf, man könne doch nicht unmittelbar vor der anbefohlenen Vorkonferenz und dem bald abzuhaltenden Landtag ein Provisorium einführen, durch das die Romanen ganz gegen die Bestimmungen des 20. Oktober benachteiligt würden. Lasser, Plener und Mecséry stimmten ihm entschieden zu, während Vay und Szécsen den provisorischen Präsidenten Kemény unterstützten. Rechberg äußerte sich nicht und vertagte die Diskussion. Am 17. Dezember wurde sie im Beisein des Kaisers fortgesetzt62. Beide Seiten fuhren schweres Geschütz auf. Rechberg, der sich für Schmerling entschieden hatte, argumentierte mit der Gefahr „revolutionärer und annexionistischer Umtriebe“ in den benachbarten rumänischen Fürstentümern, wenn die Rumänen vor den Kopf gestoßen würden. Der Flügel um Schmerling sah die Gefahr für die öffentliche Ordnung und verwies auf die Bestimmungen des 20. Oktober. Die Gegenseite drohte mit dem Schlagwort der „assemblée constituante“, sprach von vagen Experimenten und gefährlichem Zunder, lockte aber auch mit einem Kompromißangebot, nämlich die Organisierung langsam und ohne öffentliche Bekanntmachungen durchzuführen. Die Diskussion wurde zu einem Schlagabtausch der „Oktobermänner“ mit dem neuen starken Mann Schmerling. Nicht einmal zwei Monate nach Erlassung des Diploms erging man sich in spitzfindigen und gegensätzlichen Auslegungen desselben. Die Ungarn waren aber angesichts der Komitatsbewegung und der Steuerverweigerung, die inzwischen bedenklichen Ausmaße angenommen hatten, offensichtlich in der Defensive. Der Kaiser erwies sich als bestens informiert und kompetent. Er entschied, ausführlich argumentierend, im Sinn von Schmerling und Rechberg für die Beibehaltung der bestehenden (neoabsolutistischen) Organisation bis zum Ausspruch der Karlsburger Konferenz bzw. bis zu allfälligen Anträgen des zukünftigen Landtages63. Daraufhin beantragte Kemény die Einberufung einer scheinbar ausgewogenen, in Wirklichkeit mehrheitlich ungarischen Versammlung von je acht Vertretern der Ungarn, der im Osten des Landes ansässigen ungarisch sprechenden Szekler, der Sachsen, der Romanen und von acht Vertretern der königlichen Freistädte und privilegierten Marktflecken, insgesamt 40 Personen, für Mitte Februar 1861 nach Klausenburg. Diese Anträge wurden genehmigt64.
Im Vorfeld dieser Karlsburger Konferenz kam es zu zwei weiteren Versammlungen. Die Rumänen, angeführt vom griechisch-orthodoxen Bischof Andreas Freiherr v. Schaguna und vom griechisch-katholischen Bischof Alexander Sterka-Sulucz de Kerpenyes, wollten einen Nationalkongreß abhalten, was ihnen zunächst nicht gestattet wurde65. Sie wiederholten ihre Bitte, und Schmerling, der inzwischen Gołuchowski nachgefolgt war, gab mündlich die Erlaubnis zu einer „Nationalkonferenz“, die unter Beteiligung von rund 150 Personen vom 13. – 16. Jänner 1861 in Hermannstadt abgehalten wurde und gemäß einem Bericht des Gouverneurs von Siebenbürgen Friedrich Fürst v. Liechtenstein einen „friedlichen, ruhigen und loyalen Verlauf“ nahm66. Auf dieser Konferenz fielen wichtige || S. 24 PDF || Beschlüsse für die Rumänen. Die beiden Bischöfe erhielten ein Verhandlungsmandat, die Nation erklärte sich als gleichberechtigt, und man beschloß das Zusammengehen aller Rumänen ohne Unterschied der Religion67. Die von den Bischöfen daraufhin formulierten Eingaben mit den Wünschen der romanischen Nation wurden der Hofkanzlei zur Begutachtung übergeben68. Kemény ließ sie liegen, was angesichts der Kritik, die die Bischöfe an seiner Vorgangsweise übten, verständlich sein mag. Sie hatten darauf hingewiesen, daß von den 40 Vertretern für die Karlsburger Konferenz 24 Ungarn seien, während die Bevölkerung des Landes aus rund 540.000 Ungarn, 196.000 Sachsen und 1,354.000 Rumänen bestand. Das seien „Rechtsverkürzungen, welche als unvereinbarlich mit dem Grundgesetze der nationalen und konfessionellen Gleichberechtigung den Ah. Absichten unstreitig zuwiderlaufen“69.
Die Sachsen hielten vom 31. Jänner bis 2. Februar 1861 ebenfalls in Hermannstadt eine Nationalversammlung ab, auf der sie ihre Vorgangsweise abstimmten. Liechtenstein bezeichnete die Versammlung von rund 36 Vertretern der wichtigsten sächsischen Orte als „private Besprechung“, weshalb es keinen Grund gegeben habe, sie zu verbieten. Ihr Verlauf war ebenfalls ruhig, friedlich und loyal. Man beschloß gemeinsam vorzugehen, ein Majestätsgesuch um baldige Reaktivierung der sächsischen Nationsuniversität einzureichen und einen Antrittsbesuch bei Kemény und beim neu ernannten Gubernialpräsidenten Emerich Graf Mikó zu machen70.
Am 11. und 12. Februar 1861 tagte dann die Karlsburger Konferenz. Die Standpunkte der Nationalitäten lagen so weit auseinander, daß es zu keinem gemeinsamen Vorschlag über eine Landtagswahlordnung kam71. Damit begann die fast unendliche Geschichte der Einberufung des siebenbürgischen Landtags, die den Ministerrat noch oft beschäftigte. Erst die Schwächung der Ungarn mit dem Provisorium vom Herbst 1861 und die Ablösung Keménys machten Fortschritte möglich. 1863 wurde, als letzter, auch der siebenbürgische Landtag einberufen, so wie es das Oktoberdiplom verlangte72.
Wieder anders gelagert waren die Verhältnisse in dem 1849 geschaffenen Territorium Serbische Woiwodschaft mit dem Temescher Banat 73. Hier ging es nicht wie in den anderen || S. 25 PDF || Ländern um die Frage, welche Wahlordnung anzuwenden wäre. Das Gebiet sollte ja wieder zu Ungarn zurückkehren. Noch im März 1860 hatte der Kaiser „den Fortbestand der Woiwodschaft als abgesondertes Kronland als außer Frage stehend“ bezeichnet74. Anfang Juli hatte der zur Befriedung Ungarns berufene Generalgouverneur Ludwig Ritter v. Benedek nach seiner Erkundungsreise gesagt, das Begehren der überwiegenden Mehrheit der Ungarn ohne Unterschied der Nation sei die Rückkehr auf den historischen Boden der Verfassung, und dazu gehöre die „Wiederherstellung der Integrität des Landes, mindestens durch Reinkorporierung der Woiwodschaft“75. Auch in den Schönbrunner Konferenzen Ende August hatten die Ungarn unmißverständlich darauf hingewiesen: „Die Woiwodina betreffend erklärt Graf Szécsen, daß deren Aufhebung und Wiedereinverleibung in Ungarn eine der ersten Notwendigkeiten sei.“76 Allerdings müßten die Privilegien der Serben erneuert werden. Übrigens war die Woiwodina nicht als Kronland, sondern nur als Verwaltungsgebiet eingerichtet worden. Dieser Vorgeschichte entsprechend stellte das einschlägige Handschreiben an den Ministerpräsidenten die Wiedervereinigung mit Ungarn in Aussicht77. Gleichzeitig wies es aber auch auf die Wünsche und Ansprüche der serbischen Untertanen sowie auf die „vielfach abweichenden verschiedenen Ansichten der übrigen Bewohner“ (Deutsche und Rumänen) hin und versprach die Entsendung eines Kommissärs in der Person des FML. Alexander Graf Mensdorff-Pouilly, um alle Seiten zu befriedigen. Er hatte „nach Anhörung hervorragender Persönlichkeiten aller Nationalitäten und Konfessionen“ Bericht und Vorschlag zu unterbreiten. Der Kaiser brachte die Frage sofort nach der Rückkehr aus Warschau zur Sprache. Die Ministerkonferenz diskutiere ausführlich die Instruktion für Mensdorff78. Es ging vor allem um die Frage, ob Mensdorff die Vertreter der Nationalitäten in Gruppen oder in einer gemeinsamen Versammlung befragen solle. Die nichtungarischen Minister versuchten offensichtlich, die Wiedervereinigung hinauszuzögern und eine gute Absicherung der Rechte der anderen Nationalitäten zu erreichen. Gołuchowski erinnerte an das Versprechen, die Selbständigkeit nicht ohne Anhörung des Landes aufzuheben, und meinte, eigentlich müßte ein Landtag darüber befinden. Schließlich ließ man dem Kommissär freie Hand. Mensdorff reiste ins Land. Er sprach gesondert mit den einzelnen Gruppen, auch eine gemeinsame Besprechung fand statt79. Sein Bericht wurde in der Ministerkonferenz am 18. Dezember 1860 beraten80. Der neue Staatsminister Schmerling schlug vor, eine Versammlung von Vertretern aller Nationalitäten im neutralen Wien nach dem || S. 26 PDF || Vorbild der in Siebenbürgen bevorstehenden Karlsburger Konferenz einzuberufen81. Lasser rollte geradezu die Geschichte der Serbischen Woiwodschaft auf. Nach langem Hin und Her einigte man sich darauf, die Wiedereinverleibung, die das Handschreiben vom 20. Oktober nur als „Wunsch und staatsrechtlichen Anspruch“ Ungarns bezeichnet aber nicht versprochen hatte, nun „im Grundsatze“ auszusprechen und gleichzeitig Vertreter nicht aller Nationalitäten, sondern nur der Serben nach Wien einzuladen. Der serbische Patriarch von Karlowitz Joseph Rajacsich wurde beauftragt – wir kennen die folgende Formulierung – „Männer, welche durch Stellung, Talent, geleistete öffentliche Dienste und durch den Besitz des öffentlichen Vertrauens hervorragen“ auszuwählen und nach Wien zu senden. Sie sollten eine königliche Proposition, also den Entwurf eines Gesetzartikels für den ungarischen Landtag ausarbeiten. Den Rumänen sollten beruhigende Zusicherungen erteilt werden. Diese Vorgangsweise genehmigte der Kaiser am 27. Dezember82. Diese serbische Vertrauensmännerversammlung kam aber nicht zustande, weil Patriarch Rajacsich nicht einverstanden war und sich unter Berufung auf sein Gewissen weigerte, den Auftrag zu erfüllen. Das Handschreiben vom 20. Oktober hatte bei den Serben eine intensive Diskussion über ihre Zukunft ausgelöst, und die Entschließung vom 27. Dezember hatte dieselbe verstärkt. Es gab sehr unterschiedliche Meinungen. Der Patriarch teilte daher der Regierung mit, Vertrauensmänner hätten keine Vollmacht, und nur ein wirklicher Nationalkongreß könne verbindliche Aussagen treffen83. Am 23. Jänner 1861 wurde die Ministerkonferenz mit dieser neuen Situation konfrontiert. Erst einen Monat später, am 19. Februar, beriet sie in der Sache84. Der Staatsminister hatte sich inzwischen informiert, und offensichtlich hatten man sich mit der ungarischen Seite schon im Vorfeld darauf geeinigt, der Bitte der Serben nach Abhaltung eines Nationalkongresses wenn auch nur „ausnahmsweise“ nachzukommen. Damit war der Weg frei für den serbischen Nationalkongreß, der vom 2. bis 20. April 1861 in Karlowitz tagte. Es war die letzte der Nationalitätenversammlungen, die aufgrund des Oktoberdiploms bzw. seiner begleitenden Handschreibens zustande gekommen ist. Daß seine Beschlüsse nie wirklich umgesetzt wurden, steht auf einem anderen Blatt und kann nicht dem Oktoberdiplom angelastet werden.
Anders war die Situation im lombardisch-venetianischen Königreich. Schon am 27. Oktober 1860 war man sich in der Ministerkonferenz einig, daß das Land einen Anspruch auf ein Landesstatut habe, daß aber die politische Situation – gemeint war der im Gang befindliche Staatsbildungsprozeß jenseits der Grenzen – gegen die Konstituierung eines Landtags zu diesem Zeitpunkt spreche. In Lombardo-Venetien gab es aber die Zentralkongregation. Sie hatte zwar bei weitem nicht die Kompetenzen wie die alten Landtage in Ungarn oder in Kroatien-Slawonien, auf die man dort zurückgreifen konnte, sie war aber im Lande als althergebrachte Einrichtung anerkannt und existierte immerhin noch, || S. 27 PDF || während die Landstände der cisleithanischen Länder nicht nur überholt, sondern auch tot waren. Die Regierung verfiel daher auf den Ausweg der Aufwertung der Zentralkongregation anstelle einer neuen Landesvertretung. Schmerling übernahm in diesem Punkt die Auffassung Gołuchowskis. Am 19. Jänner 1861 schlug er vor, zur Beratung dieser Frage Vertrauensmänner aus dem lombardisch-venezianischen Königreich nach Wien zu berufen. Obwohl die Minister zustimmten, ist es nicht dazu gekommen, nur informell hat sich Schmerling mit einigen Venezianern, die aus anderem Grund in Wien waren, beraten85. Das Februarpatent übertrug der Zentralkongregation die Aufgabe, Abgeordnete in den Reichsrat zu entsenden. Ein Landesstatut für Lombardo-Venetien wurde nie erlassen, ein Landtag nicht einberufen.
Insgesamt wurden also aufgrund des Oktoberdiploms zur Vorbereitung der Landtage in Ungarn, in Kroatien-Slawonien und in Siebenbürgen Vertrauensmännerversammlungen einberufen. In Siebenbürgen kam es zu zwei informellen Vorkonferenzen. In Dalmatien wurden Vertrauensleute einberufen, sie kamen aber nicht nach Agram. In der serbischen Woiwodschaft wurde sogar ein serbischer Nationalkongreß gestattet. Nur in Lombardo-Venetien blieb es bei der Ankündigung und bei inoffiziellen Gesprächen. Die Versammlungen beschäftigten nicht nur die Ministerkonferenz, sie wurden auch von öffentlichen Diskussionen und Zeitungsberichten begleitet. Das Oktoberdiplom hat also den öffentlichen politischen Diskurs in vielfacher Weise hervorgerufen.
Landesstatute - Retrodigitalisat (PDF)
Um in den „übrigen“, also im wesentlichen in den cisleithanischen Ländern zu Landtagen zu kommen, mußte ein anderer Weg beschritten werden: es waren die Landesstatute zu erlassen. Diesen Schritt ordnete das erste Handschreiben an den zum Staatsminister ernannten Innenminister an86. Gołuchowski wurde beauftragt, „unverweilt die Entwürfe für die […] Landesordnungen und Statute zu unterbreiten“. Das Handschreiben faßte auch ganz kurz die wesentlichen Grundlagen und Rechte der Landtage zusammen: Vertretung aller Stände und Interessen nach den Bedürfnissen der Gegenwart; Mitwirkung bei der Gesetzgebung; Anträge in Landesangelegenheiten; selbständige Verwaltung des Landesvermögens. Es ist verständlich, daß diese wenn auch vagen Formulierungen Genugtuung auslösten, wurde doch hier zum ersten Mal seit 1848/49 konkret etwas versprochen. Im selben Handschreiben wurde der Staatsminister beauftragt, die Veröffentlichung der vier schon genehmigten Landesordnungen und Statute für Steiermark, Kärnten, Salzburg und Tirol einzuleiten. Die Öffentlichkeit erfuhr also auch, daß vier Statute schon erlassen waren, wieder eine konkrete Aussage. Der eingangs erwähnte Satz aus der Zeitung „Die Presse“ gewinnt so an Gewicht: „Alle übrigen Detailbestimmungen bleiben späteren Entscheidungen vorbehalten. Wie wichtig nun auch mit vollem Recht diese letzteren besonders jenen Kronländern erscheinen mögen, welche sich bis jetzt noch keiner gesetzlich berechtigten Vertretung erfreuten, so sind doch die Grundsätze, || S. 28 PDF || nach denen diese Landesordnungen zu verfassen sind, in dem kaiserlichen Diplom vom 20. Oktober und dem Ah. Handschreiben vom gleichen Datum mit so großer Deutlichkeit ausgesprochen, daß über das diesfällige Ergebnis unserer Ansicht nach kein berechtigter Zweifel aufrechterhalten werden kann.“87
Es wurde schon gesagt, welch große und mit jedem publizierten Statut wachsende Enttäuschung diese vier Landesordnungen auslösten, weil sie diese Versprechungen nicht wirklich einlösten und weil die Unterschiede zu Ungarn hervortraten. Die Regierung ging aber vorerst unbeirrt an die Durchführung des Auftrags. Anfang November 1860 legte Gołuchowski die Statute für Oberösterreich und Krain, Mitte November jenes für Böhmen, am 1. Dezember das mährische Statut vor88. Es fehlten noch Niederösterreich, Schlesien, Galizien, Bukowina, Dalmatien und das Küstenland. Die Diskussionen gingen sehr ins Detail, sie waren ernsthaft, keinesfalls provisorisch. Der politische Stimmungswandel passierte außerhalb der Konferenz. Wenn er andeutungsweise auch in der Konferenz zur Sprache gebracht wurde, so brauchte es doch eine gewisse Zeit, bis der politische Wechsel erfolgte. Als aber die Ablehnung der vier bereits publizierten Statute durch die Öffentlichkeit einen bestimmten Punkt erreicht hatte, geschah der Wechsel von Gołuchowski zu Schmerling ziemlich abrupt. Am 5. Dezember wurde das mährische Statut verabschiedet. Am 6. und am 8. Dezember tagte die Konferenz zu anderen Themen, dann folgte eine für die Sitzungsfrequenz dieser Monate ungewöhnliche Pause von fünf Tagen. Am 14. Dezember war wieder Konferenz – ohne Gołuchowski, mit Schmerling.
Es ist interessant, von diesem Wechsel her zurückzuschauen und die Diskussionen über die Landesordnungen im November 1860 zu lesen. Vor allem Szécsen wurde zum mahnenden Cato. Schon am 27. Oktober wies er darauf hin, daß laut dem Kärntner Statut der Landtag bei Landesgesetzen nur „Beirat zu üben“ statt „mitzuwirken“ habe, und er verlangte eine kaiserliche Äußerung, daß die vier beschlossenen Statute, von denen zu diesem Zeitpunkt erst zwei publiziert waren, nur im weitergehenden Sinn des Diploms vom 20. Oktober zu interpretieren seien89. Wiederholt verlangte er eine neue grundsätzliche Besprechung aller Landesstatute. Die neue Regierung sei nicht bloß der Redakteur der vom früheren Ministerium vertretenen Grundsätze90. Szécsen war auch der erste, der die Frage des passiven Wahlrechts der Landtagsabgeordneten aufwarf. Nach den Gołuchowskischen Statuten mußten die Abgeordneten Mitglieder einer Gemeindevertretung sein. Szécsen, aber rasch auch die Mehrheit der Minister sahen darin eine unzulässige und politisch unkluge Einschränkung. Ein tüchtiger Gemeindevertreter mußte nicht auch ein guter Abgeordneter sein, und es gab viele hervorragende Persönlichkeiten für die Landtage, die nicht in den Gemeindestuben saßen oder sitzen wollten91. Ein weiterer Punkt, den zuerst Plener ansprach, war die fehlende Gleichberechtigung zwischen || S. 29 PDF || den cisleithanischen Landtagen und jenen der ungarischen Krone92. Am 29. November kam er in anderem Zusammenhang darauf zurück. In einem eigenhändigen Zusatz zum Protokoll schrieb er von „tiefer Kränkung“ der nichtungarischen Kronländer, von der „Notwendigkeit eines moralischen Gegengewichtes“ zu Ungarn, von der „Schaffung einer kräftigen Vertretung der nichtungarischen Länder“ und daß die „bereits erschienenen und noch zu erwartenden Landtagstatuten“ dazu keinesfalls genügten. Plener forderte die Aufwertung des (engeren) Reichsrates. Lasser unterstützte wortgewandt den Finanzminister. Szécsen verteidigte sich selbst und die ungarischen Oktobermänner. Sie hätten keine Bevorzugung, sondern die Gleichstellung beansprucht. „Es war die Ansicht, daß auch die ‚Mitwirkung’ der außerungarischen Landtage eine entscheidende sein sollte […]. Ein wesentlicher Unterschied wurde nicht angestrebt.“93 Er hatte recht. Niemals hatten die Ungarn eine Bevorzugung verlangt, im Gegenteil, sie hatten ausdrücklich die Gleichberechtigung für alle Kronländer gewünscht. Am 16. Oktober hatte Szécsen bemerkt, „daß es seiner Meinung nach wünschenswert wäre, wenn die legislativen Attribute der Länder der ungarischen Krone im Prinzipe – wenn auch nicht in der Form – gleichfalls den übrigen Kronländern Ah. zuerkannt würden“. Apponyi hielt sogar „den Erfolg der im Zuge begriffenen großen Maßregel durch die minder günstige Behandlung der deutsch-slawischen Länder gefährdet. In Ungarn ist die allgemeine Stimmung gegen eine solche Ungleichheit“. Und Georg Mailáth hatte bedauert, „daß durch die ungleiche Behandlung dieser Länder der alte Dualismus und Gegensatz der Kronländer wieder hervorgerufen wird“94. Gołuchowski und der Kaiser selbst hatten dem Reichsrat und den Landtagen nur eine eingeschränkte, verwaschene „Mitwirkung“ in der Gesetzgebung zugestanden. Nun zeigte es sich, daß die Ungarn (und der deutschliberale Plener) recht gehabt hatten.
Daß die Ungarn auf den Sturz Gołuchowskis hinarbeiteten, geschah also nicht nur, um ihren durch die kritische Zuspitzung der Lage in Ungarn gefährdeten Ausgleichsversuch vom 20. Oktober dadurch zu retten, daß wenigsten die cisleithanischen Länder für das Oktoberdiplom gewonnen würden. Es war durchaus konsequent. Sie hatten die Gleichberechtigung schon früher vorgeschlagen. Am 8. Dezember 1860 telegrafierte Szécsen aus Wien an den inzwischen zum Tavernikus ernannten Mailáth nach Buda: „Gegründete Aussicht, daß Schmerling ins Ministerium tritt, anstatt Gołuchowski. […]. Schmerling Programmdurchführung des 20. Oktober für die deutsch-slawischen Provinzen in unserem ursprünglichen Sinn. Hinsichtlich Ungarns und der Nebenländer ehrliches Festhalten am 20. Oktober […].“95
Mit dem Rücktritt Gołuchowskis und der Berufung Schmerlings ins Staatsministerium war also der Maschinist in bezug auf die deutsch-slawischen Länder ausgetauscht. Anton Ritter v. Schmerling hatte bereits 1848, er war damals 33 Jahre alt, eine bedeutende Rolle gespielt, war österreichischer Abgeordneter in der deutschen Nationalversammlung der Frankfurter Paulskirche, dann Reichsminister für Inneres, Ministerpräsident und || S. 30 PDF || Minister der Äußern gewesen. 1849 – 1851 bekleidete er das Amt des Justizministers im Kabinett Schwarzenberg, aus dem er – ein seltener Fall – freiwillig ausschied96. Schmerling, inzwischen Oberlandesgerichtspräsident in Wien, war die große Hoffnung der Deutschliberalen. Als Rechberg ihm das Amt des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes mit der faktischen Funktion eines Justizministers anbot, konnte er selbstbewußt sagen, er würde dem Kabinett nur als Staatsminister angehören. So geschah es97. Am 20. Dezember 1860 schlug Schmerling in der Ministerkonferenz die Änderung des Wahlrechts vor. Das Wahlrecht der Gołuchowskischen Statute war in der Öffentlichkeit und auch schon in der Ministerkonferenz kritisiert worden. Schmerling plädierte zunächst für die Trennung zwischen Gemeinde- und Landtagswahlen. Das aktive Wahlrecht für die Landtage sollte von der Steuerleistung abhängen, es sollte allen aus der ersten und der oberen Hälfte aus der zweiten Steuerklasse zukommen. Lasser zeigte, wie ungerecht dies sei, und schlug vor, die gesamte zweite Steuerklasse zuzulassen98. Die Bedenken Rechbergs wegen zu viel politischer Agitation durch zu viele Wahlen wurden ebenso zerstreut wie seine Befürchtung, man erzeuge so „politische Körper“. Szécsen meinte trocken, dies sei „unter allen Umständen nicht zu umgehen“. Die Konferenz stimmte zu. Eine Woche später schlug Schmerling vor, das passive Wahlrecht dem aktiven anzugleichen, d. h. überhaupt keinen Unterschied zu machen99. Nachdem dieser Vorschlag mit vier zu drei Stimmen angenommen war, schlug er gleich noch vor, die Einschränkung der Wählbarkeit nach dem Wahlbezirk fallen zu lassen. Jeder, der im Kronland wählbar war, sollte in allen Wahlbezirken des Kronlandes gewählt werden können. Auch diese Bestimmung wurde mit vier zu drei Stimmen angenommen. Das mehrfach wiederholte Hauptargument war, die besten Köpfe in die Landtage und damit in den Reichsrat zu bekommen. Die im Vergleich zu früher atemberaubende Ausweitung des aktiven und passiven Wahlrechts nahm der Kaiser am 2. Jänner 1861 wenn auch besorgt zur Kenntnis, nur einen kleinen Kompromiß ordnete er an, wohl um den unterlegenen Stimmführern entgegenzukommen: Aus der zweiten Wählerklasse sollte das Wahlrecht weder der oberen Hälfte, noch allen, sondern den oberen zwei Dritteln zukommen100. Die neuen Regeln wurden sogar durch Verordnung des Staatsministers in das Reichsgesetzblatt eingerückt101.
Am 15. Jänner 1861 nahm die Ministerkonferenz die Arbeit an den Landesordnungen wieder auf, und zwar in scheinbarer Fortsetzung vom 1. und 5. Dezember 1860 an jener für die Markgrafschaft Mähren. In Wirklichkeit handelte es sich um eine ganz neue Vorlage. Die Gołuchowskischen Entwürfe wurden ganz fallen gelassen, statt dessen wurden || S. 31 PDF || die Landesordnungen aus den Jahren 1849/50 zur Grundlage genommen102. Bernhard Ritter v. Meyer, Ministerialrat im Staatsministerium, hat die Vorgänge beschrieben: „Wenige Tage, nachdem derselbe [Schmerling] das Staatsministerium übernommen hatte, ließ er mich aus meinem Winkel daselbst zu sich in sein Büro berufen, wo ich bereits einige wenige meiner Kollegen versammelt fand. In seiner gewohnten freundlichen Weise wurden wir von demselben begrüßt und uns dann die Eröffnung gemacht, daß es sich um Entwerfung neuer Landesordnungen handle, und daß er diejenigen im Ministerium noch vorhandenen Herren, die früher unter Bach an solchen gearbeitet, mit dieser Arbeit betrauen wolle. Als Leitfaden habe uns das Oktoberdiplom zu dienen, welches genau die Kompetenzen der Reichsvertretung von denen der Landtage ausscheide. Den Entwurf der Grundgesetze der Reichsvertretung sowie der allgemeinen Reichsverfassung behalte er sich selbst vor, für die Landesordnungen und auch die Landeswahlordnungen mögen wir uns unter Beobachtung des Oktoberdiplomes an die Bachschen Entwürfe103 halten, jedoch mit dem Unterschiede, daß jede ständische Gliederung der Vertretung zu entfallen und an deren Stelle eine Vertretung nach Interessengruppen zu treten habe. Wenn der Klerus mit Ausnahme der Bischöfe aus dem Bachschen Elaborate hinausgeworfen wird, so seien in den drei anderen Ständen – Großgrundbesitz, Städte und Industrie, Landbevölkerung – die aufzunehmenden Interessengruppen gegeben. So kam ich wieder gegen alle meine Erwartung zur Bearbeitung eines Stückes Verfassung; die Arbeit war eine sehr leichte für uns Wenige, die wir damit beauftragt waren; wir nahmen das Oktoberdiplom zur Hand, dann die Landesstatute von Bach, einigten uns in ein paar Besprechungen über eine Schablone nach den Andeutungen, die uns von dem Staatsminister gegeben worden, und in kurzer Zeit waren die Landesordnungen mit den Landeswahlordnungen eine fertige Arbeit“104.
Die Behandlung des Statuts für Mähren am 15. Jänner 1861 verlief glatt, es wurden einige Änderungen der Vorlage beschlossen. Was überhaupt nicht angesprochen wurde, weil offenbar unbestritten und für alle Beteiligten klar, waren zwei grundlegende Änderungen. || S. 32 PDF || Erstens war im neuen Entwurf der ständische Charakter weitgehend aufgegeben und durch das Prinzip der Interessenvertretung abgelöst. Nicht mehr Klerus, Adel, Bürger (Städte) und Bauern (Landgemeinden) waren die Kategorien, sondern großer Grundbesitz, Städte und Märkte mit Handels- und Gewerbekammern, und übrige Gemeinden. Immerhin findet sich im Protokoll vom 20. Dezember anläßlich der Debatte über den Wahlmodus eine sehr direkte Formulierung zu diesem Thema. Lasser, der oft sehr ausführlich und geradezu schulmeisterlich sprach, sagte damals, und die Stelle ist durch seine eigenhändigen Korrekturen besonders wichtig, „der Festsetzung der Wahl durch die Gemeindevertretung liege das der ständischen Auffassung innewohnende Prinzip zum Grunde, die Gemeinde als solche […] im Landtage vertreten zu lassen, während der gegenwärtig vorgeschlagene […] Modus eine Interessenvertretung zu erzielen beabsichtigt und daher, weil die Interessenvertretung sich am deutlichsten durch die Teilnahme an den Staatslasten, namentlich an den Steuern, kundgebe, nicht die Gemeinden, sondern die Steuerträger zur Repräsentation im Landtage beruft“105. Die zweite Änderung betraf die legislative Gewalt. Während in den Gołuchowskischen Statuten die Landtage bloß „Beirat zu üben“ oder „mitzuwirken“ hatten und auch der Artikel I des Oktoberdiploms nur unscharf formuliert war – freilich mit Absicht, um den Unterschied zu Ungarn zu verschleiern106 –, hieß es im neuen Entwurf unmißverständlich: „Zu jedem Landesgesetze ist die Zustimmung des Landtages und die Sanktion des Kaisers erforderlich.“107
Damit hatten die cisleithanischen Landtage formalrechtlich mit dem ungarischen Landtag gleichgezogen. Diese beiden Änderungen waren natürlich in allen Landesordnungen enthalten, die in den folgenden Wochen diskutiert und beschlossen wurden.
Darüber hinaus brachten die neuen Landesordnungen zusammen mit dem Grundgesetz über die Reichsvertretung eine wichtige Klärung, die sowohl im Oktoberdiplom als auch in den vier publizierten Landesstatuten völlig offen geblieben war, nämlich die Kompetenzverteilung zwischen den cisleithanischen Landtagen und dem engeren Reichsrat. Der Artikel I des Oktoberdiploms hatte festgelegt, daß Gesetze in Zukunft durch den Monarchen nur unter Mitwirkung entweder der Landtage oder des Reichsrates zustande kommen konnten. Wie war aber die Kompetenzaufteilung zwischen diesen beiden Körpern, Landtag bzw. Reichrat? Artikel II legte deshalb fest, bei welchen Gesetzen der Reichsrat mitzuwirken bzw. bei welchen er zuzustimmen hatte. In diesem Artikel war „der“ Reichsrat im Sinn des für das ganze Reich zuständigen gesamten Reichsrates gemeint. Artikel III, erster Absatz, sagte, daß die übrigen, nicht im Artikel II (taxativ) aufgezählten Materien in die Kompetenz der Landtage fielen. Artikel III, zweiter Absatz, führte überraschend ein neues Organ ein. Er sprach von den Ländern, die nicht zur ungarischen Krone gehörten, nannte sie „übrige Länder“, und sagte, daß gewisse Gegenstände ihnen gemeinsam seien und daß für diese Gegenstände der Reichsrat || S. 33 PDF || „unter Zuziehung der Reichsräte dieser Länder“ mitzuwirken habe. Das war nichts anderes als der spätere sogenannte engere Reichsrat, das zukünftige cisleithanische Parlament. Was man im Artikel III vergeblich sucht, ist eine Angabe, welche Gegenstände diesen Ländern gemeinsam waren und welche nicht gemeinsam waren, also in die ausschließliche Landeskompetenz fielen. Die Kompetenzverteilung zwischen dem engeren Reichsrat und den cisleithanischen Landtagen war nicht geregelt.
Man hat zwischen dem Oktoberdiplom und dem Februarpatent einen Widerspruch gesehen und jenes föderalistisch, dieses zentralistisch bezeichnet. Dieses sich hartnäckig haltende Urteil ist falsch, es beruht auf einem Mißverständnis. Ein solcher Widerspruch ergibt sich, wenn man den Eingang des Artikels III des Oktoberdiploms mit dem Grundgesetz über die Reichsvertretung, § 11, zweiter Absatz, vergleicht. Die genaue Lektüre zeigt aber, daß sich diese beiden Stellen nicht auf dasselbe Organ beziehen, mithin der Vergleich unzulässig ist. Artikel III, erster Absatz, des Oktoberdiploms spricht vom Reichsrat im Sinn des für das ganze Reich zuständigen gesamten Reichsrates und sagt weiters, daß jene Gegenstände, die nicht im Artikel II aufgezählt waren, also „alle anderen Gegenstände der Gesetzgebung [vom Monarchen …] in und mit den betreffenden Landtagen […] erledigt werden“. Die Generalkompetenz – „alle anderen“ – liegt also bei den Landtagen, die Reichratskompetenzen sind die Ausnahme davon. Paragraph 11 des Grundgesetzes vom Februar 1861 scheint dieses Verhältnis umzukehren, die Generalkompetenz dem Reichsrat zu geben und die Landeskompetenzen als Ausnahme zu erklären. Paragraph 11 spricht aber gar nicht vom gesamten, sondern nur vom engeren Reichsrat: „Zu diesem engeren Reichsrate gehören […] alle Gegenstände der Gesetzgebung, welche nicht ausdrücklich durch die Landesordnungen den einzelnen im engeren Reichsrat vertretenen Landtagen vorbehalten sind“. Diese Bestimmung ist kein Widerspruch zum Oktoberdiplom. Es hat ja bereits der zweite Absatz des Artikels III des Oktoberdiploms die Kompetenzen der cisleithanischen Landtage zugunsten der Versammlung „der Reichsräte dieser Länder“ eingeschränkt, allerdings ohne nähere Angaben dazu108. Auch die vier Statute vom 20. Oktober 1860 hatten gar nichts darüber ausgesagt, auf welche Gegenstände sich die Landeskompetenz erstreckte. Wenn man vergleicht, welche Kompetenzen „der“ Reichsrat im Sinn des für das ganze Reich zuständigen gesamten Reichsrates einerseits im Artikel II des Oktoberdiploms und andererseits im § 10 des Grundgesetzes über die Reichsvertretung hat, und nur dieser Vergleich ist zulässig, dann wird man keinen Unterschied feststellen. Es ist ja auch undenkbar, daß die ungarischen Teilnehmer der Ministerkonferenz Szécsen und Vay einer konträren Verhältnisbestimmung zwischen Reichsrat und ungarischem Landtag zugestimmt hätten. In die Verhältnisbestimmung zwischen dem engeren Reichsrat und den cisleithanischen Landtagen mischten sie sich aber nicht ein, und diese war im Diplom vollkommen offen gelassen. Im Gegenteil, Szécsen hatte ja in dem zitierten Telegramm geschrieben: „Schmerling Programmdurchführung des 20. Oktober für die deutsch-slawischen Provinzen in unserem ursprünglichen Sinn“. Zusammen hatten der engere Reichsrat und die cisleithanischen Landtage gemäß dem § 11 des Grundgesetzes über die Reichsvertretung gleich || S. 34 PDF || viel Kompetenzen wie der ungarische Landtag. Man kann nicht einmal von Akzentverschiebung sprechen, weil das Oktoberdiplom überhaupt keinen Akzent gesetzt hatte und die Landeskompetenzen nach den Gołuchowskischen Statuten denkbar klein waren, eben ein Grund für die öffentliche Enttäuschung. In Wirklichkeit griff Schmerling auch in der Klärung dieses Verhältnisses nur auf 1849/50 zurück. Bereits damals lag die Generalvollmacht beim Reich und die Landeskompetenzen waren die Ausnahme. Die damaligen Landesverfassungen formulierten es so: „Alle Angelegenheiten, welche nicht durch die Reichsverfassung oder durch Reichsgesetze als Landesangelegenheiten erklärt werden, gehören zum Wirkungskreise der Reichsgewalt.“109 An dieser Stelle sei auf zwei Wortmeldungen hingewiesen, die am 24. November 1860 in anderem Zusammenhang, nämlich Leitung der Presse, gefallen waren. Szécsen hatte auf einen Zeitungsartikel hingewiesen, in dem gesagt wurde, die Statute von 1849/50 bestünden immer noch zu Recht und seien nicht außer Kraft gesetzt worden. Und Plener hatte in einer langen eigenhändigen Einfügung die öffentliche Enttäuschung über die vier Landestatute und die Notwendigkeit eines kräftigen Gegengewichtes gegen Ungarn festgehalten110.
Die unterschiedlichen Interpretationen waren wohl auch eine Folge der „Unklarheit“ des Oktoberdiploms. Es verwendete sowohl den Ausdruck Reichsrat als auch den Ausdruck Landtage in zweideutiger Weise. Einmal war der gesamte, einmal der noch nicht so bezeichnete engere Reichsrat gemeint. Einmal waren die Landtage der Länder der ungarischen Krone „im Sinn ihren früheren Verfassungen“ mit reichen Kompetenzen, dann wieder die cisleithanischen Landtage „im Sinn ihrer Landesverfassungen“, die man nur mit geringen Kompetenzen ausstatten wollte, gemeint. Die mangelnde Schärfe des Begriffs war Absicht und eben die Folge des Kompromißcharakters des Diploms, das auch manches in Schwebe ließ.
Eine inhaltliche Gleichstellung der cisleithanischen Landtage mit dem ungarischen Landtag wollten die Deutschliberalen gar nicht, sie wollten ein kräftiges Parlament. Wieder können wir auf eine unmißverständlich klare Formulierung Pleners zurückgreifen, die er als vergeblicher Warner am 16. Oktober 1860 deponiert hatte. Die Öffentlichkeit werde sehr bald die Bevorzugung Ungarns feststellen und daran die Forderung nach Gleichstellung knüpfen. „Über die Form dieser Gleichstellung könne man allerdings sehr verschiedene Ansichten haben, und nur soviel ist gewiß, daß man nicht die zahlreichen Landesvertretungen, jede mit einer großen legislativen Gewalt ausstatten könne. Allein, die legislativen Attribute des verstärkten Reichsrates dürften dagegen eine Erweiterung erfahren.“ Und weiter: „Eine Verteilung der gesetzgeberischen Mitwirkung auf 21 Landtage || S. 35 PDF || sei ein Unding, werde außer von einigen aristokratischen Fraktionen von niemandem in Österreich gewünscht; vielmehr gehe der allgemeine Wunsch – wenigstens der gesamten deutsch-slawischen Bevölkerung in der großen Menge des Mittel- und Bürgerstandes und wohl auch des rationelleren Teils des Bauernstandes – nach einer Gesamtvertretung im Zentrum, nach einem konstitutionellen Reichsorgan, durch dessen Einsetzung den nichtungarischen Untertanen nur dasselbe gewährt würde, was für Ungarn geschehen solle.“111
Auch der „Aristokrat“ Heinrich Jaroslav Graf Clam-Martinic hat sich in diesem Sinn geäußert. Im Verlauf der Schönbrunner Konferenzen gestand er eine gemeinsame Gesetzgebung für die deutschen Kronländer und so etwas wie eine Kurie dieser Kronländer im Reichsrat zu. Er sagte, „daß man in den deutschen Kronlanden diejenigen legislativen Geschäfte, die der Gleichartigkeit der Verhältnisse wegen zweckmäßig vom Zentralorgane zu behandeln wären, wohl nicht für die verschiedenen einzelnen Landtage reklamieren würde. Er betrachte es daher als eine offene Frage, ob im Reichsrate eine eigene Kategorie außerungarischer gemeinsamer Geschäfte aufgestellt werden könnte“112.
Genau das brachte nun die neue Politik Schmerlings. Vergleicht man die Kompetenzen der Landtage der Länder der ungarischen Krone mit den Kompetenzen, die der engere Reichsrat und die cisleithanischen Landtage gemeinsam hatten, ergibt sich wieder kein wesentlicher Unterschied. Man könnte sogar sagen, daß das Februarpatent den föderalistischen Gedanken in bezug auf die deutsch-slawischen Kronländer trotz eines starken Parlaments ernster nahm als das Oktoberdiplom, indem es diesen Kronländern klare Landeskompetenzen mit entsprechender Landesgesetzgebung zugestand, während die Landesstatute des Oktoberdiploms nur äußerst bescheidene Landeskompetenzen ohne Gesetzgebungsrecht vorgesehen hatten.
Ab dem 15. Jänner 1861 wurden also die neuen Landesordnungen und anschließend das vom ersten begleitenden Handschreiben verlangte „organische Reichsratsstatut“ dem Ministerrat vorgelegt.
So wie im vorhergehenden Band sei auch hier ein chronologischer Überblick geboten.
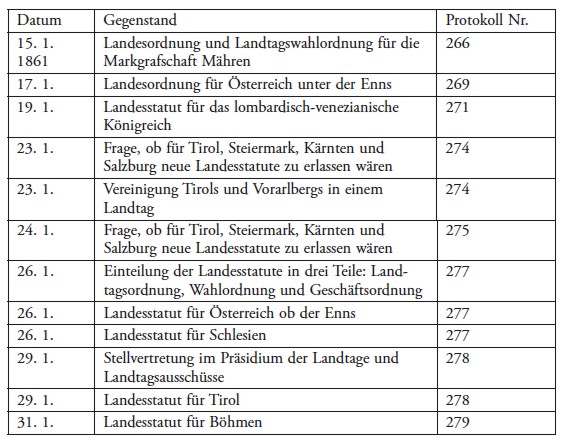
|| S. 36 PDF || Die folgenden Besprechungen fanden nach dem Wechsel im Präsidium des Ministerrates von Rechberg zu Erzherzog Rainer statt und sind im Band V/1 der Edition enthalten:

Selfgovernment - Retrodigitalisat (PDF)
Das große Thema des Ministerprogramms vom 21. August 1859, die Selbstverwaltung in Gemeinden, Bezirken, Kreisen und Ländern mit dem doppelten Ziel der finanziellen Entlastung des Staates und der Stärkung der lokalen Führungsschichten auf Kosten der Zentralbürokratie, war durch das Oktoberdiplom etwas in den Hintergrund gedrängt, es war aber nicht vergessen worden113. Die Präambel sprach von der „geregelten Teilnahme Unserer Untertanen an der Gesetzgebung und Verwaltung“. Die Artikel des Diploms selbst widmeten sich nur der Gesetzgebung. Von der Verwaltung sprachen die begleitenden Handschreiben.
Die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Institutionen in Ungarn betraf natürlich auch die Verwaltung. Deshalb waren die verschiedenen Gesetze und Ordnungen zu diesem Themenbereich, die von Gołuchowski bis zum 20. Oktober 1860 als dem noch für das ganze Reich zuständigen Innenminister vorbereitet und vorgelegt worden waren, jetzt nur mehr, wenn überhaupt, für Cisleithanien brauchbar. Die Zuständigkeit für die Länder der ungarischen Krone lag in allen diesen Dingen bei den betreffenden Kanzlern. In Ungarn wurden die Komitatsverfassungen wiederhergestellt. Die Obergespäne sollten vorläufig Komitatsausschüsse und einen Komitatsmagistrat einsetzen, die definitiven Regelungen waren dem ungarischen Landtag vorbehalten114. Die Durchführung wurde mit der Instruktion für die Obergespäne eingeleitet115. Die weiteren Schritte lagen nicht mehr im Wirkungsbereich der Zentralregierung. Der Ausbau der Selbstverwaltung fiel aber bald dem Provisorium vom Herbst 1861 zum Opfer. Am 5. November 1861 wurden sämtliche Komitats-, Distrikts- und Magistratsausschüsse aufgelöst116. Erst nach dem Ausgleich wurde das Thema aufgegriffen, wobei es langfristig nicht zum Ausbau, sondern zur Einschränkung der Lokalverwaltung zugunsten der Zentralbehörden gekommen ist117.
Zur Lokalverwaltung in Kroatien-Slawonien und in Siebenbürgen schwiegen die begleitenden Handschreiben, doch galt die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Institutionen natürlich auch für diese Länder. Für beide wurden entsprechende Instruktionen in der Ministerkonferenz besprochen und anschließend erlassen, nämlich für Kroatien-Slawonien die „Instruktion für die provisorische Organisierung der Komitate, freien Distrikte, königlichen Freistädte, privilegierten Marktflecken und Landgemeinden“118, für Siebenbürgen die „Instruktion für die Obergespäne in den Komitaten, für den Oberkapitän im ungarischen Distrikt Fogaras und für die Oberkönigsrichter in den Szekler Stühlen“119. || S. 38 PDF || In Kroatien-Slawonien blieb die auf Grundlage dieser provisorischen Instruktion organisierte Lokalverwaltung lange in Geltung, weil modernisierende Reformbestrebungen weder auf dem Landtag von 1861 noch in der Zeit nach 1867 umgesetzt werden konnten120. In Siebenbürgen wurde die Beteiligung der nichtungarischen Nationalitäten an der Lokalverwaltung zum zentralen Thema. Gegen den zähen Widerstand der Magyaren entstand doch ein politisches Gleichgewicht zwischen den Nationalitäten in der Verwaltung der Komitate und Munizipien. Mit dem Klausenburger Unionslandtag von 1866 und mit dem Ausgleich von 1867 änderten sich die Verhältnisse grundlegend121.
Für die cisleithanischen Länder war das begleitende Handschreiben an Gołuchowski – als Staatsminister nur mehr für diese Länder zuständig – der Ausgangspunkt für die Weiterbehandlung von Selfgovernment bzw. Lokalverwaltung122. In bezug auf die oberste Selbstverwaltungsebene, die Länder, hieß es dort nur, daß sie über die Aufbringung der Mittel für die Landeserfordernisse zu beschließen und die Verwendung und Kontrolle des Landesvermögens zu besorgen hatten. Die vier schon beschlossenen Landesstatute enthielten – außer der unumstrittenen Mittelaufbringung für Landeszwecke und der Verwaltung des Landesvermögens – nur jene zwei Bereiche, die Gołuchowski anknüpfend an das Ministerprogramm vom 21. August 1859 aufgenommen hatte, nämlich Mitwirkung bei der Steuereinhebung sowie Gemeindeaufsicht. Daß der Landtag in einigen Bereichen (Bodenkultur, wohltätige Anstalten usw.) „beraten und im Rahmen der bestehenden Gesetze Beschlüsse fassen“123 durfte, kann nicht als wirkliche Autonomie bezeichnet werden. Das Selfgovernment im Sinne einer Rückkehr zum Patrimonialsystem war schon in den Verhandlungen über das Ministerprogramm im August 1859 abgelehnt worden. Die weitergehenden Vorschläge Brucks, den Ländern einen „übertragenen Wirkungskreis“ zuzugestehen, hatte der Kaiser selbst im März 1860 abgelehnt. Es sei nicht zulässig, daß eine ständische neben der landesfürstlichen Regierung bestehe124.
Was sahen diesbezüglich die neuen Landesordnungen des Februarpatents vor, mit denen der Auftrag des begleitenden Handschreibens an Gołuchowski nunmehr von Schmerling durchgeführt wurde? Ein ausdrücklicher übertragener Wirkungskreis fehlt auch hier. Es wurden aber, wieder in fast wörtlichem Rückgriff auf die Landesordnungen von 1849/50, einige Politikfelder ohne Einschränkung als Landesangelegenheit erklärt125. Die Nähe zu den Vorschlägen Brucks vom März 1860 ist unverkennbar. Der betreffende Paragraph wurde in der Ministerkonferenz nur anläßlich des Landesstatuts für Mähren am || S. 39 PDF || 15. Jänner 1860 kurz diskutiert, weitere Debatten waren offenbar nicht nötig. In Kombination mit der Bestimmung, daß der Landesausschuß die „vollziehbaren Landtagsbeschlüsse“ auszuführen hatte126, ergab sich doch der Kern und die Möglichkeit einer Landesverwaltung. Sie wurde freilich nicht so schnell wirksam. Die landesfürstliche Verwaltung in der Hand des Statthalters blieb lange Zeit dominant. Dennoch entwickelte sich langsam, ohne daß die Landesordnungen wesentlich geändert werden mußten, eine immer kräftigere Landesverwaltung der cisleithanischen Länder bis hin zu einer Arbeitsteilung zwischen Staat und Ländern127.
Ein Sonderbehandlung erfuhr Lombardo-Venetien. Eine Landesordnung wurde, solange das Land bei Österreich verblieb, nicht erlassen, wie oben gesagt. Immerhin wurden die Kompetenzen der Zentralkongregation ein wenig erweitert128.
In bezug auf die unteren Ebenen, – Kreisgemeinde, Bezirksgemeinde, Ortsgemeinde – kam es schon Mitte November zu einer überraschenden Änderung des vorgezeichneten Wegs. Der Staatsminister war im begleitenden Handschreiben aufgefordert worden, „die Entwürfe über die Gemeindeordnungen und die Gutsgebiete und die Einrichtungen der Selbstverwaltung in Kreisen und Bezirken ausarbeiten zu lassen und Meiner Entscheidung zu unterziehen“. Die Selbstverwaltung sollte sich demnach in vier Arten von Gesetzen verwirklichen, die im Prinzip für jedes Kronland separat zu erlassen waren, nämlich in der untersten Ebene, also in den Landgemeinden und Städten, in einer Gemeindeordnung oder einem Gemeindegesetz (die Begriffe wurden synonym verwendet), dann in Gesetzen für die sogenannten Gemeinden höherer Ordnung Bezirk und Kreis, die je nach Bedarf und je nach Größe des Kronlandes zwischen die Ortgemeinde und das Land treten konnten, und schließlich, gemäß der Forderung des alten Feudaladels, in Gesetzen über die Möglichkeit, den Großgrundbesitz – die Gutsgebiete – aus dem Gemeindeverband ausscheiden zu können. Die meisten dieser Gesetze hatten schon zu heftigen Debatten in der Ministerkonferenz geführt129. Gołuchowski sah es in seiner bürokratischen Art als seine Aufgabe, alle diese Gesetze vorzulegen, den gesamten Staatsaufbau aus einem Guß zu gestalten. Dagegen hatten auf der einen Seite Thun, auf der anderen Plener vorgeschlagen, diese Materien den Ländern bzw. den Landtagen zu überlassen130. Der Kaiser hatte in diesem Punkt für Gołuchowski entschieden und ihm im zitierten begleitenden Handschreiben den Auftrag gegeben, die Entwürfe vorzulegen. Damit sind wir aber bei einer weiteren unklaren Stellen. Was sollte mit diesen Entwürfen geschehen? Es handelte sich um Gesetze. Sollten sie so wie das Diplom selbst und die Landesordnungen || S. 40 PDF || oktroyiert werden? Das wäre ein offener Widerspruch zu Artikel I gewesen. Sollten sie den Landtagen vorgelegt werden? Damit wären sie wieder vielfachen Änderungsvorschlägen unterworfen worden, und es hätte viel Zeit gekostet, bis sie in Kraft treten konnten. Alle wußten aber, daß die Zeit drängte. Schon am 29. Oktober 1860 hatte der Finanzminister auf die dringende Notwendigkeit einer baldigen Einberufung des Reichsrates hingewiesen. Die Militärausgaben würden eine Finanzoperation erfordern, dazu brauche es den Reichsrat131. Dessen Abgeordnete waren aber von den Landtagen zu entsenden, und die Landtagsabgeordneten waren von den Gemeinden zu entsenden. Gemeindewahlen hatte es zuletzt 1850 gegeben. Als die erste dreijährige Periode zu Ende war, verhinderte die inzwischen neoabsolutistische Regierung Neuwahlen. Auf freigewordene Stellen setzte sie Personen ihres Vertrauen132. So hatten die im Jahre 1860 bestehenden Gemeindevertretungen in keiner Weise mehr das Vertrauen der politisch interessierten Schichten. Es kam nun aber auch teilweise zum kollektiven Rücktritt aller Gemeinderäte, z. B. in Graz und in Salzburg133. Wie konnte man diesen gordischen Knoten zerhauen?
Am 13. November 1860 schlug der neue Polizeiminister Mecséry vor, einfach Neuwahlen nach dem provisorischen Gesetz von 1849 anzuordnen. Er wies auch darauf hin, daß ein neues Gesetz die Mitwirkung des Reichsrates brauche. Das Protokoll sagt nicht, ob er auch vorschlug, die Materie prinzipiell den Landtagen zu überlassen. Aus der Antwort Gołuchowski ist aber zu entnehmen, daß dies im Raum stand. Der Innenminister lehnte den Vorschlag ab, aber alle anderen Minister traten Mecséry bei. Der Diskussionsverlauf und die abschließende Entscheidung des Kaisers lassen darauf schließen, daß das Protokoll das Ende einer vorausgegangenen Debatte festhält. Der Kaiser entschied, daß Neuwahlen abgehalten werden sollten und daß die Ausarbeitung der Gemeindegesetze den Landtagen zu überlassen seien. Damit war das Handschreiben an Gołuchowski vom 20. Oktober in diesem Punkt vollkommen umgedreht. Der Kaiser folgte in diesem Punkt nicht mehr dem Staatsminister, sondern übernahm die früher von Thun und Plener geäußerten, offenbar auch von den Ungarn bevorzugten Ideen. In dieser Frage trat die Änderung des Weges also schon einen Monat früher ein, als in der Frage der Landesstatute. Schließlich wurde Ende Dezember, wie oben dargelegt, die Wahl der Landtagsabgeordneten überhaupt von den Gemeinden abgesondert. Mit Verordnung des Staatsministeriums vom 26. November 1860 wurden Gemeindewahlen nach dem provisorischen Gemeindegesetz von 1849 angeordnet134. Die Rathäuser wurden wieder häufig, zumindest in den Städten, vom liberalen Bürgertum besetzt. 1862 kam das Reichsgemeindegesetz zustande. Auf seiner Grundlage haben die Landtage die Landesgemeindeordnungen, in manchen Kronländern auch Bezirks- und Kreisgemeindegesetze, in zwei Kronländern (Galizien und Bukowina) auch ein Gesetz über die Gutgebiete ausgearbeitet. Die Gemeinden erhielten neben dem selbständigen auch einen vom Staat übertragenen Wirkungskreis. Es trat also auch auf Gemeindeebene neben die landesfürstliche, d. h. staatliche, || S. 41 PDF || eine autonome Verwaltung. Die Wünsche der Feudalen nach weitgehender Ausscheidung des großen Grundbesitzes kamen nur in ganz wenigen Ländern zum Zug135. Blickt man von dieser Entwicklung zurück auf das Ministerprogramm vom 21. August 1859 und auf die programmatischen Formulierungen im Vortragsentwurf Gołuchowskis vom 2. Oktober 1860, so sieht man, daß die Grundanliegen dieser Dokumente in Cisleithanien durchaus verwirklicht worden sind, wenn auch nach Gołuchowski und mit anderen politischen Akzentsetzungen als damals intendiert. Jedenfalls wurden „gewisse Geschäfte an nicht landesfürstliche Organe übertragen“136, und „das Prinzip der Selbstverwaltung, ernstgemeint und wohlverstanden“137 hat in den cisleithanischen Kronländern Fuß gefaßt138.
In lockerem Zusammenhang mit der Selbstverwaltung stand das Anliegen der Trennung der Justiz von der Verwaltung. In der ersten Instanz, den gemischten Bezirksämtern, war diese Trennung nicht vorhanden. Das Handschreiben an den Staatsminister ordnete auch „in kürzester Frist die Anträge zur Durchführung des Grundsatzes der Trennung der Justiz von der Administration“ an. Gołuchowski war zwar für die Trennung139, hatte aber bis zu seiner Entlassung wohl keine Zeit für einen entsprechenden Antrag. Im Frühjahr 1861 wurde der Gegenstand im Rahmen einer neue Gerichtsverfassung behandelt, bei der man auch wie bei den Landesstatuten auf 1850 zurückgriff. Der Gesetzentwurf gelangte zwar vor den Reichsrat, doch ist es erst nach 1867 zur Durchführung der Trennung gekommen140.
Aufbau der neuen Verwaltung in den Ländern der Stephanskrone - Retrodigitalisat (PDF)
Die alte ungarische Verfassung war bekanntlich kein Verfassungsdokument im heute gebräuchlichen Wortsinn, also im Sinne des Konstitutionalismus des 19. Jahrhunderts, sondern sie war der Inbegriff aller geltenden Normen hinsichtlich der Organisation der Staatsgewalt und der Volksrechte141. Die im Artikel III des Oktoberdiploms ausgesprochene Wiederherstellung der „früheren Verfassungen“ „in den zur ungarischen Krone gehörigen Königreichen und Ländern“ hatte daher notwendigerweise auch zur Folge, daß „die verfassungsmäßigen Institutionen […] und die diesem Lande […] zukommende politische und Justizverwaltung“ wiederhergestellt wurden142. Die nach 1849 eingeführte zentralistische Verwaltung, nach dem damaligen Innenminister Alexander Bach || S. 42 PDF || auch Bachsche Verwaltung genannt, war verhaßt. Der Ausgleich der Krone mit der Nation bezog sich keineswegs nur auf den Reichstag/Landtag und die legislative Gewalt, er erforderte unbedingt auch die Wiederherstellung der früheren Verwaltungsstrukturen. Nun stellte sich auch bei der exekutiven und bei der richterlichen Staatsgewalt so wie bei der legislativen die Frage, ob man den Zustand der Aprilgesetze von 1848 oder einen früheren wiederherstellen sollte. Da die Aprilgesetze der Revolutionszeit (verantwortliches Ministerium) für den Kaiser unannehmbar waren, hatten die Altkonservativen ein Zurückgehen auf 1847 vorgeschlagen143. Das bedeutete die Installierung eines Hofkanzlers im Zentrum des Reiches, des Tavernikus als Chef der ebenfalls wiederhergestellten Statthalterei, von Obergespänen als Leiter der Komitate, und im Gerichtswesen die Wiederherstellung der königlichen Kurie mit dem Judex Curiae an der Spitze. Als ein Element des Kompromißwerkes gab es einen wichtigen Unterschied zu früher: der Hofkanzler war nicht mehr außerhalb der Regierung, sondern er war Mitglied des Ministeriums. Die Folge war, daß die wesentlichen Organisationsfragen Ungarns in der Ministerkonferenz zur Sprache kommen mußten.
Vier begleitende Handschreiben an den ungarischen Hofkanzler widmeten sich dem Aufbau der neuen Verwaltung144. Darin wurden ihm folgende Aufträge erteilt: Unterbreitung von Vorschlägen zur Besetzung des obersten Landrichters und des Tavernikus, der „die ganze politische Administration zu übernehmen“ hatte – die Finanzverwaltung blieb ausgenommen; Vorschläge zur Organisierung der königlichen Statthalterei; Vorlage der vom Judex Curiae vorzubereitenden Anträge zur Ernennung der Mitglieder des obersten Gerichtshofes und zur Organisierung der Justizpflege; Vorschläge für die Ernennung der Komitatsobergespäne und Vorlage einer Instruktion für dieselben. Auf dieser Ebene war die Neuorganisation identisch mit der schon besprochenen Wiederherstellung der Selbstverwaltung. Die Protokolle des vorliegenden Bandes sowie der nachfolgenden Bände enthalten viele Tagesordnungspunkte zu diesem Themenkomplex. Gewiß haben die Minister die bezüglichen Vorlagen des Hofkanzlers weitgehend zur Kenntnis genommen. Mehr Diskussionsstoff zu Ungarn boten die besorgniserregenden Zustände wie die Komitatsbewegung, die Steuerverweigerung und später die Auseinandersetzungen mit dem ungarischen Landtag. Es ist jedoch festzuhalten, daß die mit dem Oktoberdiplom eingeleitete Neuorganisation der Verwaltung in Ungarn tatsächlich durchgeführt wurde. Infolgedessen wurden auch tausende „Bachsche Beamte“ von ihren Dienststellen entfernt145. Mit dem Provisorium vom November 1861 wurde zwar der Tavernikus durch einen Statthalter ersetzt, die Komitats- und Magistratsausschüsse wurden aufgelöst, es wurden Bachsche Beamte wieder eingestellt. Insgesamt aber wurde nicht die neoabsolutistische Verwaltung zurückgeholt. Es wurde Personen ausgetauscht, man ging autoritär-zentralistisch vor, || S. 43 PDF || es wurde aber nicht das ganze System geändert. Hofkanzler Vay wurde schon im Juli 1861 abgelöst, die Hofkanzlei blieb aber bestehen. Die im Frühjahr 1861 genehmigten Beschlüsse der sogenannten Judexkurialkonferenz, mit denen die Justizpflege reorganisiert worden war, blieben in Kraft146. Es gelang sogar, die Zustimmung des ungarischen Landtags zu erreichen.
Zur Verwaltung in Kroatien-Slawonien und in Siebenbürgen schwiegen die begleitenden Handschreiben. De facto wurde aber in diesen Ländern der gleiche Vorgang eingehalten wie in Ungarn. Als erstes wurden Repräsentanten im Zentrum des Reiches ernannt, also der provisorische Präsident der wiedererrichteten siebenbürgischen Hofkanzlei und der Leiter des kroatisch-slawonischen Hofdikasteriums147. Sie legten Anträge zur Organisierung der neuen Zentralstelle vor. Der Banus für Kroatien-Slawonien und der Zivil- und Generalgouverneur für Siebenbürgen blieben im Amt, für Siebenbürgen wurde ein provisorischer Präsident des Guberniums ernannt. In den Komitaten wurden die Obergespäne ernannt, und sie erhielten neue Instruktionen. Wie in Ungarn bestand die Neuorganisation auf dieser Ebene im Zurückgehen auf die frühere Selbstverwaltung, von der schon die Rede war. Auch in Kroatien-Slawonien und in Siebenbürgen mußten viele Bachsche Beamte ihre Schreibtische räumen. In diesen beiden Ländern kam es nicht zu einem Provisorium wie in Ungarn, auch wenn der kroatisch-slawonische Landtag aufgelöst wurde.
Territorialfragen - Retrodigitalisat (PDF)
Nach der Kapitulation Ungarns bei Világos im August 1849 hatte die kaiserliche Regierung eine Neueinteilung des Landes vorgenommen. Aus einigen Komitaten Ungarns und aus Teilen des kroatischen Komitats Syrmien (Ruma und Illok) wurde das Verwaltungsgebiet „Serbische Woiwodschaft mit dem Temescher Banat“ gebildet und aus Ungarn ausgegliedert148. Siebenbürgen und Kroatien-Slawonien wurden, wie es schon die oktroyierte Märzverfassung vorgesehen hatte, von Ungarn getrennte Kronländer149. Siebenbürgen wurde um drei ungarische Komitate und einen ungarischen Distrikt, die sogenannten Partes Regni Hungariae, vermehrt150. Kroatien-Slawonien erhielt das zum Komitat Zala gehörige Gebiet zwischen der unteren Mur und der Drau, die sogenannte Murinsel (Međimurje, Muraköz, Zwischenmurgebiet). Die Stadt Fiume und das dazugehörige || S. 44 PDF || Gebiet war faktisch schon 1848 an Kroatien angeschlossen worden, und § 73 der Märzverfassung hat das bestätigt. Das verbliebene Ungarn wurde in fünf Verwaltungsgebiete aufgeteilt. Dalmatien blieb selbständig, ein Anschluß an Kroatien-Slawonien wurde nur als möglich bezeichnet151.
Die ungarischen Politiker hatten stets auf der Einheit des Landes bestanden. Die Forderung nach Wiederherstellung der Einheit war schon in den ersten Annäherungsgesprächen im Herbst 1859 erhoben worden152. Die Wiedervereinigung der fünf Verwaltungsgebiete war schon im Frühjahr 1860 diskutiert und im Handschreiben an Benedek vom 19. April 1860 zugestanden worden153. Benedek hatte im Juli 1860 „die Wiederherstellung der Integrität des Landes, mindestens durch Reinkorporierung der Woiwodschaft“ als wichtiges Anliegen bezeichnet154. In Schönbrunn hatten sich Szécsen und Apponyi klar für die Wiedereinverleibung der Woiwodina ausgesprochen. Bei Siebenbürgen zeigten sie sich kompromißbereit, es könne „für jetzt“ selbständig bleiben155. Das war wohl Taktik. Szécsens Grundgedanken – die Anerkennung der historisch-politischen Individualitäten, die Anknüpfung an die geschichtlichen Organismen, die Wiederherstellung der alten Verfassung – beinhalteten ohnehin auch die territoriale Integrität des Königreichs.
Im Oktoberdiplom waren diese Ideen weitgehend verwirklicht worden. Nicht alles aber war klar formuliert, im Gegenteil, von den vielen Territorialfragen wurden überhaupt nur zwei angesprochen, nämlich Kroatien-Slawonien und die serbische Woiwodschaft. Dennoch kam es in der Folge zwischen den Ländern und zwischen den Nationalitäten unter Berufung auf die Bestimmungen vom 20. Oktober zu einem Tauziehen um territoriale Fragen, denn viele Territorialfragen waren im Grunde Nationalitätenfragen. Die Ministerkonferenz bzw. der Ministerrat waren der Ort, wo diese Fragen zur Vorentscheidung oder zur Entscheidung kamen.
In bezug auf Kroatien-Slawonien wies das begleitende Handschreiben an den Banus Šokčević „die Frage der Verhältnisse dieser Länder zum Königreiche Ungarn“ „der Beratung und Verständigung der kroatisch-slawonischen Vertretung und des ungarischen Landtages“ zu. Dahinter verbarg sich der Konflikt zwischen dem ungarischen Anspruch, daß Kroatien-Slawonien integrierender Teil der Länder der ungarischen Krone sei, und der Auffassung des kroatischen Staatsrechts, daß nach dem Krieg von 1848/49 jede rechtliche Verbindung zwischen Kroatien und Ungarn aufgehört habe. Durch die Zuweisung der Frage an die beiden Landtage nahm also die Krone einen neutralen Standpunkt ein und behielt sich nur die Entscheidung und Sanktion vor156. Im November und Dezember wurde dieser Konflikt in der Ministerkonferenz mehrmals angesprochen. So regte Szécsen am 13. November 1860 an, ohne daß ein konkreter Anlaß genannt wurde, die Regierung solle über die Entwicklung in Kroatien informiert werden, || S. 45 PDF || „zumal die Rückwirkung der kroatischen Frage auf die ungarische sehr groß ist“157. Zwei Tage später beriet die Konferenz über die Durchführung der Komitatsverfassung in Kroatien. Szécsen warnte davor, auf diesem Umweg wichtigen territorialen Fragen, die zwischen Ungarn und Kroatien ausgetragen werden müßten, vorzugreifen. Lasser brachte den Konflikt zwischen Kroatien und Ungarn auf den Punkt: „Denn nicht die Nationalitätsfrage ist in Kroatien den Ungarn gegenüber heiklich, weil kein Kroate dermal fürchte, magyarisiert zu werden, aber die territorialen Errungenschaften vom Jahre 1848 bilden den Punkt, wo das kroatische Gefühl am tiefsten verwundbar ist“158. Zwei Wochen später, am 27. November, und dann erneut am 2. und am 4. Dezember, lagen die Bitten der Banalkonferenz vor, darunter die Errichtung einer Hofkanzlei. Auch darin sah Szécsen einen Vorgriff „über die Hauptfrage der Union oder Nichtunion“. Die weitere Debatte an diesen Tagen über Dalmatien, auf die noch eingegangen wird, war auch ein stellvertretendes Scharmützel zum Verhältnis Kroatiens zu Ungarn159. Am 26. Dezember 1860 lagen die Vorschläge für die Besetzung der Präsidentenstelle des kroatisch-slawonischen Hofdikasteriums vor, und sie zeigen sehr deutlich den vorbereitenden Kampf der Parteien. Der eine wurde von den Ungarn „als entschiedener Parteigänger [der kroatischen Seite]“ „perhorresziert“, auch der andere „gelte in ungarischen Kreisen als zu kroatisch“, und nur ein dritter „könne als neutraler Mann gelten“160. Ganz offen brach der Streit am 2. Jänner 1861 aus. Anlaß war der Vortrag des ungarischen Hofkanzlers über das Ergebnis der Graner Konferenz und über die Einberufung des ungarischen Landtags. Die Landtagseinberufung war nämlich für die Ungarn der Hebel, um die Forderung nach der territorialen Integrität des Reiches aus der Randlage ins Zentrum der Diskussion zu bringen. Ohne die Einberufung der Abgeordneten aus allen zur Krone gehörigen Gebieten könne kein gesetzlicher Landtag im Sinn der wiederhergestellten Verfassung zustande kommen, und ohne gesetzlichen Landtag könne es keine Krönung geben, argumentierten sie. Der Präsident des kroatisch-slawonischen Hofdikasteriums und der Banus protestierten heftig gegen diese Auffassung. Die Verständigung zwischen Kroatien und Ungarn, die das Handschreiben vom 20. Oktober verlange, könne nur durch Deputationen der beiden Landtage an einem neutralen Orte geschehen, keineswegs aber könne der ungarische Hofkanzler Kroaten zum ungarischen Landtag einberufen. Der neue Staatsminister Schmerling, obwohl von den Ungarn protegiert, nahm entschieden Partei für die Kroaten. Der Sinn und die Absicht des Handschreibens sei es, „daß ein ungarischer Landtag ohne kroatische Abgeordnete bestehe“161. Vay drohte daraufhin sogar mit seinem Rücktritt. Von gleicher Schärfe war die Diskussion am 5. Jänner 1861, und zwei Tage später entschied der Kaiser den Vortrag des ungarischen Hofkanzlers dahin, daß die Entscheidung über die Berufung von Kroaten zum ungarischen Landtag später erfolgen würde162. Die Kroaten hatten sich vorerst durchgesetzt, und so blieb es || S. 46 PDF || auch bei einem erneuten Versuch im März. Selbst einer der für Szécsen so typischen Kompromißvorschläge – die Einladung vorzunehmen, aber ihre Folge vom Ergebnis der Verhandlungen abhängig zu machen – nützte nichts, eine Verständigung zwischen Kroatien und Ungarn über ihr staatsrechtliches Verhältnis und über die von Ungarn geforderte Union gelang nicht. Erst sieben Jahre später, unter geänderten Rahmenbedingungen, konnte Ungarn sein Ziel erreichen, indem die Kroaten zum Ausgleich mit Ungarn gedrängt wurden163.
Die zweite Territorialfrage, die am 20. Oktober benannt wurde, war die Eingliederung der Serbischen Woiwodschaft mit dem Temescher Banat in Ungarn. Davon war schon oben im Kapitel über die Vertrauensmännerversammlungen die Rede. Mit Ah. Entschließung vom 27. Dezember 1860 wurde die Wiedereingliederung angeordnet. Am 5. Jänner 1861 wurden die Komitatsobergespäne ernannt164, am 26. Jänner wurde die Statthalterei in Temesvár aufgelöst, ab 1. Februar 1861 übernahm die ungarische Statthalterei ihre Geschäfte165.
Eine kurze Aufregung gab es wegen des südwestlichen Teiles der Woiwodschaft, der Bezirke Ruma und Illok südlich der Donau. Sie waren wegen ihrer serbischen Bevölkerungsmehrheit der Woiwodschaft zugeordnet worden, gehörten aber staatsrechtlich zum slawonischen Komitat Syrmien. Die Entschließung vom 27. Dezember 1860, die am 30. Dezember in der Wiener Zeitung publiziert wurde, sprach nur von der „Wiedereinverleibung der Serbischen Woiwodschaft und des Temescher Banats in das Königreich Ungarn auf Grundlage der staatsrechtlichen Ansprüche dieses Königreiches auf die erwähnten Gebietsteile“. Der Ban protestierte sofort. Franz Joseph schrieb folgendes Billett an Rechberg: „Der Banus ist sehr bestürzt, daß bei Vereinigung der Woiwodina mit Ungarn, Syrmien, welches immer zu Slavonien gehörte, nicht diesem zurückgegeben wurde. Mir ist es leider entgangen und es steckt, scheint mir, eine kleine ungarische Perfidie dahinter. Da die Sache sehr dringend ist, bitte ich heute abends die Konferenz zu mir zu bestellen; den Banus habe ich schon bestellt.“ Das Protokoll dieser Konferenz ist im vorliegenden Band nachzulesen. Ruma und Illok blieben bei Kroatien-Slawonien. Die öffentlich Klärung wurde nach dem Antrag Szécsens ohne die Person des Kaisers ins Spiel zu bringen auf Ministerebene herbeigeführt, nämlich durch ein Schreiben der zuständigen Minister, des Staatsministers und des ungarischen Hofkanzlers, an den Präsidenten des kroatisch-slawonischen Hofdikasteriums166.
Siebenbürgen erhielt mit dem 20. Oktober 1860 eine Hofkanzlei und einen Landtag zugesprochen. Über das Verhältnis des Landes zu Ungarn war aber mit voller Absicht nichts gesagt. Auch hier gab es die Forderung nach der Union seitens Ungarns und die Ablehnung seitens vieler Landesbewohner. Als der neuernannte Präsident der Hofkanzlei, Kemény, am 15. Dezember 1860 die Wiederherstellung der administrativen Einteilung || S. 47 PDF || des Landes nach dem Stand von 1847 vorschlug, war indirekt die territoriale Frage aufgeworfen167. Die Rückkehr zur früheren Einteilung hätte die Rumänen benachteiligt. Mit Ausnahme von Vay und Szécsen lehnten alle Minister den Vorschlag entschieden ab und verwiesen auf die bald stattfindende Karlsburger Konferenz. Dort forderten die ungarischen Vertreter offen die Union Siebenbürgens mit Ungarn auf der Basis des Gesetzartikels VII/1848168. Die Rumänen lehnten die Union ab, die Sachsen befürworteten sie mit Vorbehalten169. Immer öfter kommt von da an der Ausdruck auch in den Ministerratsprotokollen vor170. Schmerling fand, um ein Beispiel zu zitieren, die Frage nicht reif zur Entscheidung, der Kaiser tadelte „die Agitation des Grafen Mikó für die Union“ und bezeichnete sie „als ganz ungeeignet“171. Der ungarische Landtag von 1861 erhob dann offen die Forderung nach der Union. Ihr wurde nicht stattgegeben. Die Würfel zugunsten Ungarns fielen erst mit dem siebenbürgischen Unionslandtag von 1865/66172.
Auch die Frage der siebenbürgischen Partes war am 20. Oktober 1860 nicht direkt angesprochen worden, allerdings hatten „die alten Komitatsbegrenzungen wieder ins Leben zu treten“173. Im Vortrag über das Ergebnis der Graner Konferenz und über die Einberufung des ungarischen Landtags hatte Vay auch die Einbeziehung der Partes beantragt174, und sie wurde genehmigt175. Es war aber nur die Einberufung von Abgeordneten dieser Gebiete zum Landtag genehmigt worden, nicht die territoriale Eingliederung. Zweimal debattierte die Ministerkonferenz kurz darüber, ohne eine endgültige Klarheit zu gewinnen176. Der ungarische und der siebenbürgische Hofkanzler hielten die Vereinigung dieser Gebiete mit Ungarn aufgrund des Gesetzartikels XXI/1836 für rechtens, Lasser meinte aber, das Handschreiben vom 20. Oktober habe in allen staatsrechtlichen Fragen bis zur Austragung im verfassungsmäßigen Weg den Status quo aufrechterhalten. Die ungarische Anschauung setzte sich durch. Am 17. Jänner 1861 wurden die vom ungarischen Hofkanzlers vorgelegten Besetzungsvorschläge für die Obergspäne in den Partes ohne Einwand von der Ministerkonferenz zur Kenntnis genommen177. Im Ministerrat am 28. Februar beantragte der Hofkanzler die Einsetzung einer Kommission zur praktischen Durchführung der Wiedervereinigung. Trotz des Einwands von Lasser wurde die Kommission genehmigt178. Die Rumänen des Komitats Zaránd petitionierten ohne Erfolg dagegen, am 24. September 1861 informierte der ungarische Hofkanzler den Ministerrat, „daß die Wiedereinverleibung der Partes rechtlich und faktisch ganz vollzogen ist“179.
|| S. 48 PDF || Zwei weitere Gebiete waren zwischen Ungarn und Kroatien heftig umstritten, die Murinsel und Fiume. Auch von ihnen war in den Bestimmungen des 20. Oktober 1860 nicht die Rede, sie kamen aber anläßlich der Einberufung des ungarischen Landtags auf die Tagesordnung. Der ungarische Hofkanzler hatte die Einberufung von Abgeordneten zum Landtag so wie für die siebenbürgischen Partes auch für das Komitat Zala einschließlich der Murinsel beantragt. Am 2. Jänner 1861 reklamierte der Ban das Gebiet für Kroatien, weil es fast ausschließlich von Kroaten bewohnt sei. Jedenfalls müsse gemäß den Bestimmungen vom 20. Oktober die Frage von den Landtagen beraten werden, bevor der Kaiser entscheide180. Die Mehrheit der Konferenz stimmte dem Ban zu. Der ungarische Hofkanzler bot, als es sah, daß seine Anträge zur Einberufung des Landtags nicht angenommen wurden, seine Demission an. Ohne die Herstellung der Integrität des Königreiches müsse er auf den Landtag und auf seinen Posten verzichten181. Am 5. Jänner 1861 wurde die Debatte fortgesetzt. Vay war diesmal abwesend, und der zweite ungarische Hofkanzler, Ladislaus Szőgyény v. Magyar-Szőgyén, vertrat wortgewandt den ungarischen Standpunkt. Seit 200 Jahren gehöre die Murinsel zu Ungarn, der zwölfjährige faktische Besitz durch Kroatien könne am unbezweifelbaren Recht Ungarns nichts ändern. Wenn ein ganzes Land, die Woiwodschaft, durch eine administrative Verfügung zurückgegeben werden konnte, dann könne dies wohl auch „mit dem kleinen Fleck“ geschehen. Der Ban machte insofern einen Rückzieher, als er nicht vom Landtag sprach, sondern nur auf der Anhörung der in Kürze zusammentretenden Banalkonferenz bestand. Schmerling befürwortete diesen „Vermittlungsantrag“, und die Minister stimmten zu182. Die Banalkonferenz sprach sich aber dahin aus, daß es nicht in ihrer Kompetenz liege, den Nachweis zu führen, und beharrte auf der Befassung des Landtages. Damit hatte sie den Bogen überspannt. Am 24. Jänner trat auch Schmerling entschieden für den ungarischen Standpunkt ein. Der Versuch Rechbergs, die Entscheidung zu verschieben, vielleicht weil sich Bischof Strossmayer an ihn gewandt hatte, nützte nichts. Der Kaiser entschied sofort, daß die Murinsel zurückgestellt werde183. Die Frage wurde, wie Mažuranić später einmal bemerkte, „auf Kosten Kroatiens“ gelöst184.
Auch auf Fiume mit seinem Gebiet wurde ungarischerseits prinzipiell Anspruch erhoben. Als in der Ministerkonferenz am 15. November 1860 die Bitte des Banus vorgebracht wurde, die Komitatsverfassung aufgrund der derzeitigen Komitatseinteilung durchführen zu können, riet Szécsen davon ab, „weil dadurch wichtige territoriale Fragen (wegen der Murinsel und Fiume), welche vorerst zwischen Ungarn und Kroatien ausgetragen werden müssen“ präjudiziert würden185. Schließlich wurde eine von Lasser vorgeschlagene strikt neutrale Formulierung angenommen. In Fiume selbst begann eine von der italienischen Bevölkerungsmehrheit getragene Agitation für die Rückkehr zu Ungarn. Im Frühjahr || S. 49 PDF || wurde sogar für kurze Zeit der Ausnahmezustand ausgerufen186. Fiume blieb bei Kroatien. Zwei Ministerratsprotokolle aus dem Jahr 1865 zeigen, daß die Standpunkte unverändert waren187. Der Kaiser meinte, „die glücklichste Lösung dieser sonst kaum lösbaren Frage wäre diese, daß Fiume zu einer reichsunmittelbaren Stadt erhoben werde“. Letzten Endes setzte sich Ungarn durch. 1870 wurde ein bis zum Ende der Monarchie dauerndes „Provisorium“ eingeführt. Stadt, Hafen und Bezirk Fiume wurden der ungarischen Regierung unterstellt, das Fiumaner Komitat wurde Kroatien-Slawonien zugeordnet188.
Zwei weitere Territorialfragen sind nach dem 20. Oktober 1860 auf die Tagesordnung gekommen, obwohl im Diplom und in den begleitenden Handschreiben nichts davon zu lesen ist, nämlich Dalmatien und die Militärgrenze. So wie Ungarn unter dem Prätext der territorialen Integrität Ansprüche auf die Woiwodschaft, auf Siebenbürgen und auf Kroatien erhob, so forderte Kroatien die Angliederung Dalmatiens und der kroatischslawonischen Militärgrenze an das, wie die alte Bezeichnung lautete, „Dreieinige Königreich Dalmatien, Kroatien und Slawonien“. Und so wie sich Kroatien weigerte, die staatsrechtliche Union mit Ungarn anzuerkennen, so verweigerten in Dalmatien die italienischsprachige Intelligenz und das Bürgertum in den Städten die Fusion mit Kroatien. Darüber ist oben im Abschnitt über die Versammlungen von Vertrauensmännern berichtet worden, im Rahmen der Banalkonferenz und der geplanten Einberufung von Delegierten aus Dalmatien zur Banalkonferenz. Die Regierung war in dieser Frage gespalten und blieb bei der „dilatorischen Behandlung“, d. h. die Entscheidung wurde hinausgezögert, womit letztlich gegen die Vereinigung entschieden wurde189.
Die langgezogene kroatisch-slawonische Militärgrenze im Süden der Monarchie war seit dem 16. Jahrhundert im Kampf gegen das Osmanische Reich errichtet worden. Sie war staatsrechtlich gesehen unbestritten ein Teil Kroatiens, doch war ihre Verwaltung ebenso eindeutig den militärischen Behörden unterstellt und von Zivilkroatien ausgenommen. Dasselbe galt für die zu Ungarn gehörende Banater Militärgrenze190. Es war gar nicht ein Vertreter Kroatiens, sondern Minister Lasser, der zum erstenmal davon sprach. Er lehnte die Union Dalmatiens mit Kroatien unter anderem deshalb ab, weil in diesem Fall „dieselbe auch rücksichtlich der Militärgrenze werde in Anspruch genommen werden“191.
|| S. 50 PDF || Obwohl zunächst niemand das Thema aufgriff, stand die Frage im Raum. Akut wurde sie anläßlich der Landtagseinberufung. Der Präsident des kroatisch-slawonischen Hofdikasteriums sagte am 14. Februar 1861, das ganze Land wünsche, daß die Militärgrenze auf dem Landtag vertreten sei, wie es auch schon 1848 der Fall gewesen war192. Der Kriegsminister war entschieden dagegen, und der Ministerrat lehnte die Berufung von Vertretern der Militärgrenze zum Landtag ab. Als der Kaiser am 20. Februar fragte, ob Dalmatien schon jetzt ein vollständiges Landesstatut brauche, sagte Mažuranić, die Wiedervereinigung Dalmatiens „sowie die Vertretung der Militärgrenze bewegen die Gemüter in Kroatien beinahe fieberhaft“193. Schließlich sprach der kroatisch-slawonische Landtag selbst diese Bitte aus. Da die Regierung den Landtag doch gewinnen wollte, den Reichrat zu beschicken, wurde die Beiziehung von Vertretern der Militärgrenze dann doch genehmigt, allerdings nur „zur Beratung staatsrechtlicher Fragen“194. Der Kriegsminister meinte dagegen soldatisch trocken: „Der Grenzer kennt keine staatsrechtliche Fragen, sondern nur die Befehle Sr. Majestät, die er unter allen Umständen vollzieht.“195
Zur tatsächlichen Auflösung der Militärgrenze und ihrer Wiedereingliederung in Zivilkroatien, bzw. der Banater Grenze in Ungarn, kam es erst nach dem Ausgleich. 1871 wurde damit begonnen, 1881 war die Überführung abgeschlossen196.
Es ist nicht möglich, die Entscheidung oder Nichtentscheidung in allen diesen Territorialfragen auf einen Nenner zu bringen, zu unterschiedlich waren die einzelnen Fälle. Verschiedene Argumente wurden sowohl von denen, die auf ein Territorium Anspruch erhoben, als auch von den Ministern und vom Kaiser genannt: staatsrechtlich-historische, nationalitätenpolitische, machtpolitische. Als politische Argumente muß man auch das Bestreben der Regierung werten, das kaiserliche Wort nicht zu desavouieren, und ebenso die Neutralität der Regierung in manchen Fragen. Bei den kleineren Territorien, den siebenbürgischen Partes, Ruma und Illok, der Murinsel, überwog das staatrechtlich-historische Argument. Auch die Rückgabe der serbischen Woiwodschaft an Ungarn war staatsrechtlich unumgänglich. Bei den anderen großen Gebieten, Siebenbürgen, Kroatien, Dalmatien, war das politische Kalkül stärker. Am wenigsten zog die nationalitätenpolitische Karte. Sie spielte eine gewisse Rolle in Siebenbürgen und in Dalmatien, aber nicht in der Woiwodschaft. Das Oktoberdiplom konnte und wollte diese Fragen nicht mit einem Mal lösen, vielmehr eröffnete es politische Prozesse, die zehn Jahre lang unterdrückt worden waren. Zwei Instrumente wurden am 20. Oktober 1860 anerkannt: das historische Recht und die Verständigung im Weg von Vertrauensmännerversammlungen oder im Weg der Landtage. Das eine war oft nicht eindeutig, das andere nicht erzwingbar. || S. 51 PDF || Beides ist nicht dem Diplom per se anzulasten, sondern der Kompliziertheit der tatsächlichen Probleme, oder des Problems: der Nationalitätenfrage.
Die Nationalitäten- und die Sprachenfrage - Retrodigitalisat (PDF)
Die Nationalitätenfrage war in vielfacher Weise, offen und versteckt, in den Bestimmungen vom 20. Oktober 1860 enthalten. Sie hatte Anteil an den schon besprochenen Fragen, wer auf lokaler Ebene an der Verwaltung beteiligt werden sollte, wer in die Landtage einziehen konnte, zu welchem Land ein kleineres Territorium gehören würde oder ob zwei Territorien zu vereinigen waren oder getrennt bleiben sollten. Die Vertrauensmännerversammlungen waren oft Versammlungen der Führer einer Nationalität. Ein sehr konkreter Aspekt der Nationalitätenfrage war die Sprachenfrage, d. h. die Frage, welche Sprache in der Öffentlichkeit, vor allem als Amts-, Gerichts- und Unterrichtssprache zu verwenden war.
Gołuchowski hatte in das Ministerprogramm vom 21. August 1859 einen sehr fair klingenden, aber doch sehr allgemeinen Punkt hineinreklamiert: „Die deutsche Sprache soll den nichtdeutschen Bevölkerungen nirgends aufgedrängt, sondern in allen darauf bezüglichen Fragen gewissenhaft an dem Grundsatze gehalten werden, daß, soviel es möglich, überall die Sprache angewendet werde, welche dem praktischen Zwecke, um den es sich handelt, am besten entspricht“197. Die Umsetzung dieses Punktes führte in der Ministerkonferenz zu wiederholten heftigen Debatten, aber auch zu einer tatsächlichen Änderung der einschlägigen Vorschriften198. Da aber diese Zugeständnisse aus Ängstlichkeit nicht öffentlich gemacht wurden, blieb es bei der öffentlichen Unzufriedenheit über die Vorherrschaft der deutschen Sprache. Sie machte sich in erregten Debatten im verstärkten Reichsrat Luft und fand auch einen Ausdruck im Majoritätsgutachten199.
Aufgrund dieser Entwicklung mußten die Bestimmungen vom 20. Oktober 1860 auf die Sprachenfrage eingehen. Zwei begleitende Handschreiben waren ihr gewidmet. Das eine befaßte sich mit der Unterrichtssprache an der Universität Krakau200. Der Staatsminister wurde aufgefordert, Fachmänner zu vernehmen und dann Maßnahmen vorzuschlagen, die einen Ausgleich zwischen den Wünschen der Bevölkerung und den Unterrichtsinteressen herbeiführen sollten. Dahinter verbarg sich die Forderung nach wenigsten teilweiser Polonisierung der jagellonischen Universität. Gołuchowski arbeitete mit gewohnter Effizienz und legte die Vorschläge schon am 29. November vor201. An der medizinischen Fakultät sollte weitgehend polnisch, an der philosophischen Fakultät polnisch und deutsch, an der juridischen Fakultät die allgemeinen Fächer polnisch, die spezifisch österreichischen Rechtsfächer in deutscher Sprache unterrichtet werden. Die Ministerkonferenz || S. 52 PDF || trat seinen Anträgen im wesentlichen bei. Der Akt wanderte in den ordentlichen Reichsrat und wurde dort pikanterweise vom ehemaligen Unterrichtsminister und Gegner Gołuchowskis, Graf Leo Thun, begutachtet. Der Akt wurde bis zum Ausscheiden Gołuchowskis nicht mehr erledigt, doch trat der Nachfolger Schmerling aus pragmatischen Gründen den Anträgen des Vorgängers bei. Schmerling argumentierte, das nationale Moment sei angesichts der großen Aufregung wichtiger als didaktische Überlegungen. Außerdem werde es, wenn man in Westgalizien den Polen entgegenkomme, leichter sein, die Polen in Lemberg zu beschränken und in Ostgalizien das ruthenische und deutsche Element zu größerer Geltung zu bringen202. Während somit die Polonisierung der Krakauer Universität eingeleitet wurde, mußten die Gymnasien noch mehrere Jahre warten203.
Das zweite begleitende Handschreiben zur Sprachenfrage betraf Ungarn und war an den ungarischen Hofkanzler gerichtet204. Im ersten Absatz ging es um die Amtssprache. Die ungarische Sprache wurde zur inneren Amtssprache aller politischen und Justizbehörden, nicht aber der Finanzbehörden erklärt. Die Gemeinden konnten ihre Geschäftssprache selbst wählen, und in den Versammlungen war jede landesübliche Sprache zulässig. Alle Landessprachen waren von den Behörden als äußere Amtssprachen zu verwenden, sowohl gegenüber den Bürgern als auch den Gemeinden. Der zweite Absatz galt der Unterrichtssprache der Pester Universität. Grundsätzlich sollte der Zustand vor 1848 wiederhergestellt werden, jedoch sollten noch eingehende Beratungen unter Einschluß des Lehrkörpers stattfinden. Der dritte Absatz handelte von der Unterrichtssprache an den Gymnasien. Auch da sollte die Statthalterei die Schulunterhalter und die Lehrkörper befragen und dann Anträge stellen. Die Sprachenfrage wurde mit diesem Handschreiben zur Landesangelegenheit erklärt. Es würde von den angeordneten Beratungen, vom guten Willen und von der Praxis abhängen, wie sich die Sprachenfrage in Ungarn entwickeln sollte. Der letzte Absatz versuchte die Befürchtungen der Nationalitäten vor einer Magyarisierung zu zerstreuen, indem er eine magyarisierende Interpretation des Handschreibens verbot: „Schließlich erkläre ich Meinen festen Entschluß, auf diesem Gebiete, wie auf allen, wo sich die Interessen der verschiedenen Sprachen und Nationalitäten berühren, ebenso jedem wie immer gearteten Zwange oder Drucke, als auch jedem unbefugten Hervorrufen, Fördern und Verbittern nationaler oder sprachlicher Gegensätze auf das entschiedenste entgegentreten zu wollen.“ Das war freilich eine Absichtserklärung und keine rechtswirksame Aussage. Man muß es als bedauerlich bezeichnen, daß das Oktoberdiplom die Gleichberechtigung der Nationalitäten nicht wie andere Grundrechte in der Präambel angeführt und die Sprachenfrage nicht zur Rechtssache sondern zur Verwaltungs-und Landessache erklärt hat. Immerhin hat die Regierung bald darauf versucht, eine Verrechtlichung herbeizuführen, indem z. B. für Ungarn die Ausarbeitung eines || S. 53 PDF || Nationalitätengesetzes angeordnet wurde205. Auch in dieser Frage gilt, daß die Bestimmungen vom 20. Oktober 1860 vieles nicht endgültig geregelt, sondern nur Prozesse und Gespräche eingeleitet haben, deren Ausgang durch die Formulierungen zwar beeinflußt aber nicht endgültig präjudiziert worden ist.
Das sogenannte Scheitern des Oktoberdiploms – Von Gołuchowski zu Schmerling - Retrodigitalisat (PDF)
Das Oktoberdiplom bzw. die Gesamtheit der Bestimmungen vom 20. Oktober 1860 waren also ein überaus komplexes Gebilde. Es gilt gemeinhin als gescheiterter politischer Versuch, dem rasch das nächste Verfassungsexperiment, das Februarpatent, gefolgt sei. In Wirklichkeit ist die Übertragung des naturwissenschaftlichen Ausdrucks „Experiment“ auf historische Prozesse fragwürdig, weil wohl kaum eine politische Tat, jedenfalls nicht eine so komplizierte und weittragende wie die Entscheidungen vom Oktober 1860, als reiner Versuch qualifiziert werden kann. Man würde den politischen Akteuren jede Ernsthaftigkeit absprechen. Abgesehen davon läßt die Tatsache, daß viele Inhalte umgesetzt und viele Prozesse weitergeführt worden sind, das Wort vom Scheitern problematisch erscheinen. Es ist notwendig, den Begriff präziser zu fassen. Die Krone wollte mit einem gewissen Ausmaß an Zugeständnissen rasch die politische Stabilität und die finanzielle Konsolidierung herbeiführen. Diesen Anspruch konnte das Diplom nicht einlösen, in diesem kurzfristigen politischen Ziel ist es gescheitert. Stabilität und politische Ruhe kehrten nicht ein, und es mußten bald neue Zugeständnisse gewährt werden. Die Wege aber, die das Diplom wies, sind mittel- und langfristig beschritten worden: Teilnahme der Landtage und des Reichsrates an der Gesetzgebung, Rückkehr zu verfassungsmäßigen Zuständen nach einem Jahrzehnt absoluten Regierens, Zuweisung vieler Bereiche an die historischen Länder bzw. an die Länderkomplexe (Dualismus statt Zentralismus), Eröffnung von Mitsprachemöglichkeiten für die Nationalitäten.
Die Ursachen für den kurzfristigen Mißerfolg des Oktoberdiploms sind von der Forschung bereits gut herausgearbeitet worden und haben auch hervorragende Darstellungen gefunden206. In Ungarn war es die sogenannte Komitatsbewegung, die geradezu revolutionäre Zustände einschließlich massenhafter und daher empfindlicher Steuerverweigerung herbeiführte. In Cisleithanien waren es die Deutschliberalen, die durch Rücktritte auf Gemeindeebene und durch Pressearbeit einen starken politischen Druck erzeugten. Dazu kam der Mißerfolg der außenpolitischen Anstrengungen, der „Schlag ins Wasser“ von Warschau, und die Verschärfung der Lage in Italien, die zu kostspieligen militärischen || S. 54 PDF || Maßnahmen zum Schutz Venetiens und der Adriaküste zwangen. In finanzieller Hinsicht führten diese Prozesse zum Absturz der Kurse an der Wiener Börse: „Die Papiergeldkurse sanken ins Bodenlose; im Jänner 1861 war die Valuta schließlich zu 50 % entwertet, eine Quote, die auch von den extremen Werten in der Zeit des Krimkrieges und des italienischen Krieges nicht erreicht worden war.“207 Der politische Kompromiß, der mit dem Oktoberdiplom versucht wurde208, war von zwei Seiten, den ungarischen und den deutschen Liberalen, nicht angenommen worden. Er war über ihre Köpfe hinweg oktroyiert worden. Das Diplom wollte viele befriedigen und stellte niemanden wirklich zufrieden. Er war zu sehr halbe Tat auf halbem Weg. Anton Graf Szécsen, der Vermittler und maßgebliche Architekt des Kompromisses, hat selbst die bittere Erkenntnis formuliert: „Die undankbarste Rolle in der Politik ist unstreitig jene des Vermittlers. Hüben und drüben mit scheelen Blicken betrachtet, kann er nur selten auf die Zustimmung aller jener Parteien hoffen, die zu versöhnen er sich zur Aufgabe gemacht, – geschweige die Anerkennung beider Teile erhalten.“209
Die vielen Stränge, die in den Bestimmungen vom 20. Oktober angesprochen oder indirekt enthalten waren, entsprachen den vielen politischen Problemen, die auf der Tagesordnung standen. Der erste Strang, der erste Politikbereich, in dem es offenkundig weitere Zugeständnisse der Krone brauchte, waren die cisleithanischen Landesstatute. Dieser Strang hat zur Abberufung des Innen- bzw. Staatsministers seit Sommer 1859, Gołuchowski, und zur Berufung Anton Ritter von Schmerlings zum neuen Staatsminister geführt. Daraus hat sich in dem betreffenden Politikfeld eine neue Politik entwickelt, zwar nicht in formaler, wohl aber in inhaltlicher Hinsicht. Schmerling war sehr darauf bedacht, die formalen Schritte so zu setzen, daß sie möglichst nicht in einen Widerspruch zum Oktoberdiplom gerieten. Das war gerade wegen der Unschärfe und Unklarheit des Diploms möglich, das eben keine fertigen Lösungen präsentierte, sondern Entwicklungen einleitete. In inhaltlicher Hinsicht konnte Schmerling – durchaus im Einverständnis mit den ungarischen Oktobermännern – die Konzessionen an die deutschen Liberalen ausbauen, die im Diplom nicht ganz fehlten, aber zu gering ausgefallen waren. Szécsens Telegramm an Mailáth hatte es auf den Punkt gebracht: „Schmerling Programmdurchführung des 20. Oktober für die deutsch-slawischen Provinzen in unserem ursprünglichen Sinn.“210 In der Tat hatten die von Gołuchowski entworfenen Landesstatute nicht genügt. Mit ihnen ist Gołuchowski selbst gescheitert, aber nicht das ganze Oktoberdiplom. Die Konzessionen, zu denen die neue, ins Februarpatent mündende Politik Schmerlings führte, gingen nicht zu Lasten der Ungarn oder der Zentralbürokratie, auch nicht, wie oben ausgeführt, zu Lasten der cisleithanischen Landtage, sondern zu Lasten der ständischen Politik Gołuchowskis und – zu Lasten des Kaisers. Die präzisen Formulierungen der gesetzgebenden Kompetenz des Reichrates im Februarpatent gegenüber den verschwommenen Formulierungen des Oktoberdiploms stärkten den Konstitutionalismus, den der Kaiser hatte verhindern wollen. Indem aber das Februarpatent den Kaiser || S. 55 PDF || nicht desavouierte, weil es ja in formaler Hinsicht eine Durchführung des von ihm erlassenen Oktoberdiploms darstellte, und indem damit eine wichtige politische Gruppe, die Deutschliberalen, gewonnen wurde, gewann auch der Kaiser etwas aus diesem Handel.
Den Übergang von Gołuchowski zu Schmerling verdeutlicht am besten das Protokoll vom 29. November 1860. Gegenstand war die Armeefinanzierung aufgrund der Ereignisse in Italien. Die vollkommen offene Diskussion im Beisein des Kaisers zeigt die Alternativen auf. Finanzminister Plener und Minister Lasser forderten Einrichtungen für die deutsch-slawischen Kronländer, so wie sie für Ungarn gewährt worden waren. Die ungarischen Teilnehmer – anwesend waren Szécsen und Szőgyény – versuchten zuerst, die Lage in Ungarn zu verharmlosen, dann aber sagte Szécsen, man habe vor dem 20. Oktober ungarischerseits keine Bevorzugung sondern eine Gleichstellung verlangt. Gołuchowski versuchte abzuwehren und sagte, das alles sei nichts anderes als die Einführung einer modernen Konstitution. Der Kaiser sagte zu dieser Diskussion nichts – zwei Wochen später aber, am 13. Dezember 1860, wurde Gołuchowski abberufen und Schmerling ernannt.
Am 14. Dezember nahm Schmerling zum erstenmal (wieder211) an der Ministerkonferenz teil. Zuerst gab es eine engere Konferenz über Ungarn, dann eine allgemeine Konferenz. Schmerling trat zurückhaltend aber entschieden und pragmatisch auf. Die neue Politik ließ nicht lange auf sich warten. Schon am 20. Dezember brachte er sie mit dem Vorschlag der Änderung des Wahlmodus für die Landtage zur Sprache212. Tags darauf legte er den Entwurf eines Rundschreibens an die Statthalter vor, das er anläßlich seines Amtsantritts erlassen und in der Wiener Zeitung veröffentlichen wollte213. Der Entwurf erhielt „den einstimmigen Beifall der Konferenz“. Ein Zirkularerlaß an die Statthalter war ein nicht seltener, unspektakulärer Verwaltungsakt. Dieses Rundschreiben war aber viel mehr und unterschied sich in zweifacher Hinsicht von ähnlichen früheren Akten. Es war erstens ein Schreiben des Staatsministers an die Statthalter, und mithin aufgrund der Bestimmungen vom 20. Oktober ein rein cisleithanischer Regierungsakt, und es wandte sich zweitens durch die Publikation in der Wiener Zeitung sofort an die Öffentlichkeit. Es war nichts anderes als eine Regierungserklärung für die deutsch-slawischen Kronländer214. Es sei notwendig, daß er seinem leitenden Gedanken offenen und klaren Ausdruck gebe, schrieb der Staatsminister im ersten Satz. Vergleicht man diesen ausführlichen Akt mit der geheimen Erarbeitung des Ministerprogramms vom 21. August 1859 und dessen verkürzter und bloß indirekter Mitteilung, dann wird offenkundig, daß eine neue Zeit im Anbrechen war. Schmerling bezeichnete es als seine Aufgabe, die Bestimmungen vom 20. Oktober 1860 in dem ihm zugewiesenen Gebiet umzusetzen.
Der erste Teil war eine Zusammenfassung und Paraphrase des Diploms. Er sprach von der Teilnahme des Volkes an der Gesetzgebung, die – ein bedeutender Zusatz – in allen Bestandteilen Österreichs gleichmäßig gelte; er sprach von der persönlichen Freiheit, || S. 56 PDF || von der Freiheit der Religionsausübung, von den bürgerlichen und politischen Rechten, von der notwendigen Förderung aller Nationalitäten hinsichtlich Sprache und Bildung. Er sprach von der Bedeutung der Presse, lobte ihre patriotische Haltung im letzten Krieg und versprach, daß jeder präventive Eingriff entfallen werde. Er sprach von der Bedeutung der Gemeinden, vom Gewerbe und den verschiedenen Wirtschaftszweigen. In bezug auf die Rechtspflege versprach er die Trennung der Justiz von Verwaltung sowie das öffentliche und mündliche Verfahren.
Im zweiten Teil ging er auf die politischen Institutionen ein. Die Landesstatute würden „das Prinzip der Interessenvertretung auf Grundlage unmittelbarer Wahlen und eines ausgedehnten Rechtes der Wahl und Wählbarkeit“ beinhalten, und die Landtage würden das Recht der Initiative und der Öffentlichkeit der Verhandlung bekommen. Zum zweiten Mal betonte das Rundschreiben an dieser Stelle die Gleichheit mit Ungarn. Zwei Absätze waren – ohne daß das Wort selbst verwendet wurde – dem engeren Reichsrat und seiner Aufwertung gewidmet. Ein drittes Mal wurde die Gleichberechtigung der deutsch-slawischen Länder mit den Ländern der ungarischen Krone beschworen, diesmal aus ungarischer Sicht: Die Durchführung der genannten Grundsätze werde die ungarischen Länder überzeugen, daß es der Regierung ernst sei und daß nicht zu befürchten sei, „es könnte gesucht werden, in der einen Hälfte zu unterdrücken, was in den anderen Ländern feierlich gewährt“ wurde. Der dritte Teil des Rundschreibens betraf die Verwaltung im engeren Sinn, die Statthalter, die Beamten und das strenge Festhalten an der Gesetzlichkeit.
Mit dieser Erklärung versuchte Schmerling die Erwartungen der Öffentlichkeit hüben und drüben zu erfüllen. Der nächste markante Schritt war ein interner, innerhalb der Regierung. Am 11. Jänner 1861 beschwerte er sich über vier Fälle, die sich in der kurzen Zeit seiner Mitgliedschaft im Ministerrat ereignet hatten, wo er sich übergangen fühlte. Er habe die Verantwortung mitzutragen. Solche Fälle dürften sich nicht wiederholen, „widrigens es ihm nicht mehr möglich sein würde, noch länger Mitglied des Kabinetts zu bleiben“215. Das war eine offene Rücktrittsdrohung. Gleich vier Minister mußten sich verteidigen. Der Schritt klingt wie der Versuch der Machtergreifung durch den Staatsminister, er mündete aber in einen strukturell bedeutsamen Antrag, der gar nicht auf ihn persönlich, sondern auf das Amt des Ministerpräsidenten gemünzt war: In Zukunft sollten alle Ministervorträge nur mehr durch die Hand des Ministerpräsidenten vor den Kaiser gelangen, „so wie es unter dem Ministerpräsidenten Fürsten Schwarzenberg beobachtet wurde“. Die Konferenz stimmte zu. Zwar wurde das Präsidium des Ministerrates drei Wochen später dem Präsidenten des Reichsrates, Erzherzog Rainer, übertragen und nicht Schmerling selbst, die Maßnahme stärkte aber ohne Zweifel die Einheitlichkeit der Regierung, in der Schmerling das politische Schwergewicht darstellte216.
Der dritte wichtige Schritt Schmerlings geschah weder in der Öffentlichkeit, noch im kleinen Kreis, sondern nur zwischen ihm und dem Kaiser persönlich. Wie wir aus den Erinnerungen des Staatsministers wissen, gelang es ihm im persönlichen Gespräch, || S. 57 PDF || die Ministerkonferenz übergehend, den Kaiser für folgenden Plan zu gewinnen. Um dem Druck nach Wiederherstellung der Märzverfassung oder einer ähnlichen Verfassung auszuweichen, solle der Kaiser selbst das im ersten begleitenden Handschreiben zum Oktoberdiplom vorgesehene Reichsratsstatut als eigene Schöpfung erlassen. Der Inhalt dieser „Verfassung“ solle zwischen Schmerling und dem Kaiser vereinbart werden, und erst anschließend war die Ministerkonferenz einzubeziehen217. Schmerling sicherte also dem Kaiser die vorausgehende alleinige Mitsprache zu und gewann dadurch sein Vertrauen. Schmerling arbeitete – in größter Geheimhaltung, nur assistiert von Lasser und vom Sektionsrat Hans v. Perthaler – zuerst einen Prinzipienkatalog und dann das Statut aus, besprach es mit dem Kaiser, und trat dann damit am 9. Februar vor den Ministerrat. Bereits zweieinhalb Wochen später, am 26. Februar 1861, wurde das Februarpatent mit dem neuen Grundgesetz über die Reichsvertretung und mit den cisleithanischen Landesstatuten, auch Februarverfassung genannt, erlassen218.
Die Februarverfassung war eine Konzessionen an die Deutschliberalen und an das Bürgertum in den deutsch-slawischen Kronländern. Für die Länder der ungarischen Krone brachte sie in formaler Hinsicht nichts Neues, es bestätigte vielmehr nur das Oktoberdiplom. Im Artikel II hieß es ausdrücklich, daß für diese Länder „mittels Unserer Handschreiben vom 20. Oktober 1860 bereits die geeigneten Verfügungen getroffen“ waren219.
Das Grundgesetz über die Reichsvertretung veränderte auch nicht die Kompetenzen des Gesamtreichsrates, wie oben dargelegt wurde, und nur dieser betraf ja die Länder der ungarischen Krone. Daß die Anzahl der Abgeordneten aus Ungarn erhöht wurde, war bloß eine logische Folge der Vermehrung der Gesamtzahl. Ebensowenig bedeuteten die drei begleitenden Handschreiben zum Februarpatent, an den ungarischen Hofkanzler Vay, an den Präsidenten der siebenbürgischen Hofkanzlei Kemény und an den Präsidenten des kroatisch-slawonischen Hofdikasteriums Mažuranić, in denen sie aufgefordert wurden, Anträge über die Modalitäten der Beschickung des Reichsrates zu stellen, eine Neuerung 220. Auch das Oktoberdiplom sah natürlich die Entsendung von Abgeordneten aus diesen Ländern zum Reichsrat vor. Das Oktoberdiplom wurde von den ungarischen Liberalen abgelehnt. Insofern das Februarpatent eine kräftige Bestätigung des Diploms darstellte, indem es wichtige und präzisierende Ausführungen oktroyierte, mußten sie es konsequenterweise auch oder noch mehr ablehnen. Es schwächte auch die Position der Altkonservativen. In den unklaren Formulierungen des Diploms waren mehr Ansätze für eine mögliche Verhandlungslösung mit dem ungarischen Landtag enthalten als in dem präziseren Februarpatent. Aus diesen Unterschieden zwischen Diplom und Patent ist von den Zeitgenossen und in der Literatur geradezu ein Gegensatz konstruiert worden, der aber im Wortlaut so nicht vorhanden ist. Es war ein rein politischer „Gegensatz“. Schon in der von Szécsen inspirierten Schrift „Drei Jahre Verfassungsstreit“ hieß es, „Sie [die Februarverfassung] ist nicht der Ausfluß, sondern der Gegensatz des Oktoberdiploms“, || S. 58 PDF || weil sie eine Lösung diktiere anstatt sie zu verhandeln und weil sie zwar am Wortlaut festhalte, nicht aber am Geist des Diploms221. Louis Eisenmann und mit ihm Joseph Redlich haben die Antithesen zwischen Diplom und Patent in bezug auf Ungarn herausgearbeitet222. Schon Fritz Fellner hat dieses Urteil zurechtgerückt223. Es ist jedenfalls festzuhalten, daß es sich bei der scharfen Gegenüberstellung um politische Interpretationen handelt, die erst nach dem Scheitern des Ausgleichsversuchs, welchen das Oktoberdiplom darstellte, formuliert wurden. Erst im Sommer 1861, als die Regierung und der ungarische Landtag den Weg des Kompromisses verließen, als Vay und Szécsen ihren Rücktritt erklärten, war dieser Ausgleichsversuch wirklich zu Ende224.
Die Berufung Schmerlings und die Erlassung des Februarpatents waren also keine Zäsur in bezug auf die Länder der ungarischen Krone, und die als Umsetzung der Bestimmungen vom 20. Oktober oben dargelegten Entwicklungen und Prozesse liefen unabhängig davon weiter, allen voran die Bemühungen um die Einberufung der Landtage, insbesondere des ungarischen. Ebenso bestand aber weiterhin bei vielen in Ungarn die Ablehnung des Oktoberdiploms, die schon im November 1860, nach einem kurzen Überraschungsmoment, eingesetzt und sich im Lauf der Wochen verstärkt hatte. Die ungarischen Liberalen forderten die Restitution der 1848er Gesetze, sie verlangten ein Ministerium und lehnten die Wiedererrichtung der Hofkanzlei ab. Ebenso lehnten sie die Mitwirkung am Reichsrat ab, schon nach dem Oktoberdiplom und noch mehr nach dem Februarpatent. Dieser Widerstand fand verschiedene Ausdrucksformen. Die revolutionäre Komitatsbewegung, die Steuerverweigerung, die Presse, aber auch das, was der hochgeschätzte Ferenc Deák und Josef Freiherr v. Eötvös vorbrachten, als sie von Franz Joseph um die Jahreswende in Audienz empfangen wurden225, waren nur unterschiedliche Weisen, die ungarische Position zu vermitteln, ebenso dann die Verhandlungen des ungarischen Landtages.
Dennoch erwies sich die Berufung Schmerlings auch für die ungarische Politik der Regierung als bedeutungsvoll. Das zeigte sich nicht vom ersten Tag an und auch später nicht bei allen Themen. So hat Schmerling z. B. in der Frage der Murinsel nach einem Kompromißversuch klar den ungarischen Standpunkt vertreten. Es waren die Steuerverweigerung und die scharfe Regierungskritik in den Komitaten und die Mißerfolge der Statthalterei und der Hofkanzlei gegen diese Bewegung, die eine Wende verursachten. Auf die dramatischen finanziellen Konsequenzen wies Plener am 5. Jänner hin. Er „eröffnete der Konferenz, daß er bei dem fast gänzlichen Ausbleiben der Steuern in Ungern, welchem nun auch demnächst das Gleiche in der Woiwodina und den siebenbürgischen Komitaten nachfolgen dürfte, zur Deckung der Staatsbedürfnisse“ eine Anleihe ausschreiben müsse, || S. 59 PDF || wozu der Reichsrat notwendig sei. Daran knüpfte sich eine offensive Debatte über die Verfassungsfrage226. Am 11. Jänner 1861 stellte Szécsen fest, daß „die Gestion der Komitate seit ein paar Tagen eine solche Wende zum Schlimmen genommen hat“, daß einige vom Hofkanzler vorbereitete Anträge nicht mehr genügen würden227. Es folgten die Krisensitzungen vom 15. und 16. Jänner und das königliche Reskript vom 16. Jänner 1861 an die ungarischen Komitate gegen das anarchische Treiben228, das aber nicht viel bewirkte. Von Mitte Jänner 1861 an also zeichnete sich eine entscheidende Schwächung der ungarischen Mitglieder der Konferenz ab. Die Hoffnungen, durch geduldige Verhandlung und „Transaktion“ einen Stimmungsumschwung zu erzielen, schwanden dahin. Damit mußte gleichzeitig das Gewicht der deutschliberalen Regierungsmitglieder steigen, ihre Vorschläge und Lösungsansätze mußten richtiger erscheinen als die erfolglosen ungarischen Versprechungen. Einen ersten dramatischen Höhepunkt dieser sich überkreuzenden Bewegungen hält das letzte Protokoll des vorliegenden Bandes, und damit auch das letzte Protokoll des 1859 angetretenen Kabinetts Rechberg, eindrucksvoll fest229. Schmerling stellte einleitend die Wirkungslosigkeit des Reskripts vom 16. Jänner fest und forderte unverblümt die Enthebung des Obergespans im Graner und im Honter Komitat. Schmerlings Ausdrücke im Verlauf der Diskussion ließen nichts an Schärfe zu wünschen übrig. Er sprach von offenbarer Verhöhnung, Widersetzlichkeit, flagranter Verletzung, Keckheit, offenem Widerstand. Szécsen und Vay verteidigten das Vorgehen der ungarischen Statthalterei und mahnten zur Geduld, sonst könne es keinen ungarischen Landtag geben. Den vorwurfsvollen Paukenschlag Schmerlings beantworteten sie mit offener Androhung der Demission. Wenn das Vertrauen nicht mehr vorhanden sei, „möge die Konferenz andere Mittel und Männer in Vorschlag bringen“ (Szécsen), und wenn die Konferenz weitere Maßregeln anordnen wolle, „so müßte er sich, als dafür nicht verantwortlich, seine fernere Schlußfassung vorbehalten (Vay).
Szécsen und Vay demissionierten nicht, die Oktobermänner waren noch nicht am Ende, doch wiederholten sich solche Diskussionen im neuen Kabinett unter Erzherzog Rainer ab dem 4. Februar 1861. Im Frühjahr und Sommer 1861 ging es um den am 6. April eröffneten ungarischen Landtag und um die Antwort der Regierung auf dessen Forderungen. Im Sommer 1861 erwies sich der Konflikt als nicht mehr überbrückbar, Scécsen und Vay traten zurück. Ihre Nachfolger Anton Graf Forgách als Hofkanzler und Móric Graf Esterházy als ungarischer Minister ohne Portefeuille vertraten durchaus auch den ungarischen Standpunkt, sie opponierten aber dem Staatsminister und seinem Flügel weit weniger als Vay und Szécsen. Von diesem Zeitpunkt an lenkten nicht mehr die Altkonservativen die Politik der Krone und ihrer Regierung gegenüber Ungarn, sondern Schmerling. Dies führte schließlich im Herbst 1861 zur Auflösung des ungarischen Landtags und zum sogenannten Provisorium230.
Von Rechberg zu Erzherzog Rainer - Retrodigitalisat (PDF)
Inzwischen hatte am 4. Februar 1861 jene Regierungsumbildung stattgefunden, die in formaler Hinsicht das Kabinett Rechberg beendete und durch die Betrauung des bisherigen Reichsratspräsidenten Erzherzog Rainer „mit der Leitung der Geschäfte des Ministerrates und mit dem Präsidium in demselben“ anstelle Rechbergs das Kabinett Erzherzog Rainer eröffnete. Rechberg blieb Minister des Äußern und des kaiserlichen Hauses. Der Ministerrat, wie er nun definitiv hieß, wurde außer durch die Person des freisinnigen Erzherzogs noch vermehrt um einen Ministers für Handel und Volkswirtschaft231 und um einen weiteren Ministers ohne Portefeuille, der anstelle von Lasser mit der Leitung des Justizministeriums betraut wurde232. Lasser blieb aber Minister, so daß das Kabinett nun zehn Mitglieder hatte. Es war neu ausschließlich durch die Vermehrung um vier Personen, nicht durch das Ausscheiden eines Ministers. Da die beiden neuen Minister zu den Deutschliberalen zählten, hatte Schmerling eine bequeme Mehrheit. Er war der wichtigste Mann in der Regierung, und daher wurde sie in der Literatur auch „Ministerium Erzherzog Rainer – Schmerling“ genannt233.
Gerüchte über eine Regierungsumbildung waren schon um die Jahreswende in der Presse aufgetaucht234. Sie standen offensichtlich im Zusammenhang mit der Berufung Schmerlings und mit seinem Schreiben an die Statthalter. Es hieß, Rechberg habe seinen Rücktritt eingereicht und Schmerling werde Ministerpräsident werden. Der Polizeiminister vom Sommer 1859, Josef Alexander Freiherr v. Hübner, und Alexander Graf Mensdorff-Pouilly wurden als Außenminister gehandelt (letzterer wurde es tatsächlich fünf Jahre später). Die Wiener Zeitung dementierte zu Jahresbeginn die Gerüchte: „Wir sind ermächtigt, die Gerüchte über den Austritt des Grafen Rechberg aus dem Ministerium, mit welchen die in- wie die ausländische Presse in letzterer Zeit sich so vielfach beschäftigte, als allen Grundes entbehrend zu bezeichnen“235. Einige der Vorgänge hinter den Kulissen hat Schmerling in den Denkwürdigkeiten beschrieben236. Demnach hat Rechberg um die Mitte Jänner Schmerling gefragt, ob es nicht besser sei, wenn das Präsidium des Ministerrates von Rechberg zu Schmerling überginge. Schmerling vermutete, daß Rechberg wenig Lust hatte, als Haupt eines Kabinetts dem bevorstehenden Parlament gegenüberzutreten, und Schmerling selbst war der Meinung, daß Rechberg auch gar nicht die geeignete Persönlichkeit dazu sei. Schmerling sah aber auch, daß ein solcher Wechsel eine gewisse Demütigung für Rechberg gewesen wäre und daß der Kaiser Vorbehalte gegen Schmerling als Ministerpräsident gehabt haben dürfte. Es war ein geschickter Schachzug, statt dessen den allseits geschätzten und freisinnigen Erzherzog Rainer zu ernennen. Der Kaiser gewann dadurch mehr Einfluß auf den Ministerrat, eine nochmalige Stärkung Schmerlings wurde vermieden, Rechberg wurde nicht herabgesetzt. Ob die Idee vom Kaiser selbst stammte oder vielleicht, wie Schmerling vermutete, von Rechberg, || S. 61 PDF || ist unerheblich237. Schmerling drängte bei diesem Anlaß auf eine Komplettierung des Kabinetts. Die Ernennung eines Handelsministers für das ganze Reich und einer eigenen Person für das Justizressort war schließlich auch wieder ein kleines Stück Durchführung von Bestimmungen des 20. Oktober 1860 238.
Auf den ersten Blick erscheinen die politischen Entscheidungen der Monate im Herbst 1860 und Frühjahr 1861 als widersprüchlich und sprunghaft, als reich an Zäsuren. Bei näherem Hinsehen handelte es sich um mehrere unterschiedliche und nicht synchron verlaufende Prozesse. Das Ziel war klar, es war unverändert seit dem Sommer 1859: zeitgemäße Reformen im Sinn des Laxenburger Manifests und des Ministerprogramms (was aber hieß das?) zur politischen Beruhigung in allen Reichsteilen als Grundlage für die finanzielle Konsolidierung und für die außenpolitische Stabilisierung. Zugeständnisse und Kompromisse sollten dahin führen, naturgemäß möglichst geringe. Bis zum Herbst 1860 hatten die gemäßigt Konservativen und die konservativen Föderalisten die Oberhand im Wettstreit um den politischen Einfluß, nun begannen die liberalen Kreise Terrain zu gewinnen, zunächst in Cisleithanien. Gerade der Umstand, daß die cisleithanischen Landtage im Oktoberdiplom zu kurz gekommen waren, und der daraus folgende Druck machten hier rasch weitere Zugeständnisse notwendig, und Schmerling war der geeignete Politiker, die Lage kräftig auszunützen und für die Liberalen in den deutschslawischen Kronländern viel herauszuholen. Anders war die Lage in Ungarn. Die Zugeständnisse des Oktoberdiploms waren größer, und es brauchte trotz aller Unzufriedenheit ein paar Monate mehr Zeit, bis auch in Ungarn die geradlinige Fortsetzung des Wegs, den das Diplom vorgezeichnet hatte, stockte und der Prozeß zum Stillstand kam. Das war im Sommer 1861 der Fall. Damit war, nach dem zaghaften Ausgleichsversuch vom Sommer und Herbst 1859239 auch der Ausgleichsversuch des Oktoberdiploms gescheitert. Ein weiterer vergeblicher Versuch wurde im Sommer 1863 unternommen240. Erst der 1865 begonnene führte zwei Jahre später zum Ziel241.
Der Weg zur Konsolidierung bestand also aus vielen größeren und kleineren Etappen. Solche Etappen waren der verstärkte Reichsrat, das Oktoberdiplom und die gleichzeitige Erneuerung des Kabinetts, die Berufung Schmerlings anstelle von Gołuchowski, die erweiternde Umbildung des Kabinetts Anfang Februar, das Februarpatent, die Eröffnung des ungarischen Landtags, aller anderen Landtage und schließlich des Reichsrates. Und dieser Weg, der nicht mehr in den Ministerkonferenzprotokollen des Kabinetts Rechberg, sondern in den Ministerratsprotokollen des Kabinetts Erzherzog Rainer nachzulesen ist, war noch lange nicht zu Ende.
Weitere Themen – Pressepolitik – Protestantenpatent für Cisleithanien - Retrodigitalisat (PDF)
Das Oktoberdiplom und die sich daraus ergebenden Schritte haben die Ministerkonferenz in den Monaten, die der vorliegende Band beinhaltet, in besonderer Weise in Anspruch genommen. Wie immer bieten die Protokolle auch abseits der großen Themen eine Fülle an Stoff und Quellenmaterial. Auf zwei Themen sei hingewiesen: auf die Pressepolitik und auf das österreichische Protestantenpatent.
Das erste Thema, die Pressepolitik der Regierung, steht durchaus im Zusammenhang mit der politischen Gesamtsituation, ist aber zugleich ein in sich geschlossener, aufgrund der Offenheit und Ausführlichkeit der Debatten faszinierender Quellenbestand.
Eine gemäßigte Pressepolitik ohne Zensur war schon im Ministerprogramm vom 21. August 1859 vorgesehen gewesen und unter dem Polizeiminister Alexander Freiherr v. Hübner auch tatsächlich praktiziert worden. Sein Nachfolger Adolph Freiherr v. Thierry verfolgte wieder eine restriktivere Politik. Zwar gab es keine präventive Zensur mehr, aber die Verwarnungen und Ermahnungen der Redaktionen, die die Statthalter im Auftrag der Regierung aussprachen, bedrückten die Zeitungsherausgeber in finanzieller Hinsicht und ärgerten alle, die sich eine freie Presse wünschten242. Nach dem 20. Oktober 1860 gab es eine kurze öffentliche Zustimmung, die aber bald und mit jedem Landesstatut mehr einer Enttäuschung wich. Am 17. November 1860 löste eine bestimmte Formulierung eines Journalisten eine heftige persönliche Reaktion des Kaisers aus, die wieder eine ausführliche Diskussion über die Presse in der Ministerkonferenz zur Folge hatte. Der Journalist sagte geradezu eine Volkserhebung voraus: „Wir stehen am Vorabende schwerer Tage; bis zu deren Ablauf wird es noch viele und schwere Kämpfe kosten, das ganze Volk wird sich erheben, aber nicht infolge eines Befehls, sondern weil sich seine Männer an die Spitze stellen und es zum Kampfe führen werden.“243 Erbost griff Franz Joseph zuerst zum Rotstift und zeichnete die Stelle an, dann zur Feder, und schrieb dieses Handbillet an Rechberg: „Lieber Graf Rechberg! Die im beiliegenden Wanderer rot angestrichene Stelle ist ein neuer, kolossaler Beweis, was schon geschrieben werden darf. So kann es, ohne die größten Gefahren nicht fortgehen, und ich muß das Ministerium dringend auffordern, Abhülfe zu finden. Schönbrunn, 17. November.“244
Noch am selben Tag beriet das Ministerium, und ein paar Tage später noch einmal im Beisein der Kaisers245. Der neue Polizeiminister Mecséry, ein kluger und umsichtiger Mann, hielt, offenbar bereits gut vorbereitet, ein ausführliches Referat, in dem er die Alternativen der Regierung klar anführte. Es gebe verschiedene Mittel der Repression, gesetzliche und außergesetzliche, und es gebe auf der anderen Seite die Möglichkeit der „Verständigung mit den Redaktionen“, also eine positive Politik. Die außergesetzliche Repression bringe mehr Schaden als Nutzen, die gesetzeskonforme Ahndung sei nur in wenigen Fällen wirksam. Das größte Gewicht legte er daher auf die positive Politik. Schließlich zeigte er noch einen dritten Weg auf, und daß er dies tat, beleuchtet die || S. 63 PDF || Emotionalität und die Brisanz des Themas: „Es gibt nur einen Weg noch, der allerdings offen steht, der Weg der Diktatur, er ist besser als der der halben Maßregeln. Er wird vielleicht einmal betreten werden müssen, allein, im gegenwärtigen Momente dürfte er kaum angezeigt sein.“246 Am Ende beschloß man, die Leitung der Presse zu verbessern und eine neue Instruktion auszuarbeiten, also die von Mecséry beantragte positive Beeinflussung „mit Anwendung der nötigen Geldmittel“ zu versuchen247. Aber nicht so sehr dieser Beschluß ist für uns interessant, als die Diskussion selbst, die uns die Ratlosigkeit und die Wut, aber auch die politischen Einsichten der Regierungsmitglieder mit größter Unmittelbarkeit vor Augen führen. Als eigenhändigen Zusatz Gołuchowskis etwa lesen wir: „Gegen solche verderbliche Tendenzen, welche das Volk grundsätzlich korrumpieren, müsse also mit aller Energie aufgetreten werden, wenn sich die Regierung nicht mutwillig in die Revolution stürzen will.“ Der Staatsminister sprach vom Spott, vom Wahn, von feindlicher Tendenz, von absichtlicher Entstellung durch die Presse, und das Gespenst der Revolution wurde nicht nur einmal an die Wand gemalt. Es gebe keine Regierung in Europa, die sich ungestraft so beschimpfen lasse wie die österreichische, jammerte er. Dagegen meinte der an den freieren Umgang auf den Landtagen gewohnte, eminent politische Kopf Szécsen trocken: „Nachdem die Zensur abgeschafft, müsse man sich daran gewöhnen, mit der Presse, wie sie ist, zu regieren.“ Am 24. November sagte Szécsen seinen Kollegen und dem Kaiser ins Gesicht, Repressivmaßnahmen würden die Revolution nicht verhindern, dies könne nur eine Regierung, die wisse, was sie wolle. „Man vermag sich die Frage nicht mit Bestimmtheit zu beantworten, was die Regierung in den deutsch-slawischen Provinzen will.“ Als diese Äußerung fiel, hatten die Gespräche mit Schmerling über seinen Eintritt ins Ministerium schon begonnen.
Geradezu modern und medienpsychologisch gedacht waren die Bemerkungen des Finanzministers, nicht die Presse sei schlecht, sondern die Stimmung im Publikum, und die Presse schreibe eben deshalb schlecht, sie publiziere ihre scharfen Artikel diesem zu Gefallen. Und eigenhändig fügte er an den Rand hinzu: „Nicht der Journalist erschafft die schlechte Stimmung, diese ist vielmehr schon da, er schreibt nur, wie es derselben zusagt und gibt ihr nur einen mundgerechten Ausdruck. Ein Journal, welches gegen die allgemeine Stimmung schriebe, würde zweifelsohne sehr bald eingehen, und der Egoismus des Unternehmers hält ihn von einem solchen Vorgehen ganz gewiß ab.“ Plener nannte auch offen die unmittelbare Ursache für die Verschlechterung der Stimmung: es waren die cisleithanischen Landesstatute, die die öffentliche Meinung tief verletzt hatten.
Einen Monat später erlebte diese Diskussion eine Neuauflage. Diesmal war die indirekte Forderung nach Ablösung des Ministers des Äußern Grafen Rechberg der Anlaß für die Debatte, die gleich wieder prinzipiell wurde248. Es war auch die erste Gelegenheit für den neuen Staatsminister Schmerling, seine Ansichten zur Presse zu äußern. Er versuchte zu beruhigen, indem er, auf seine Erfahrungen in Frankfurt 1848/49 verweisend, meinte, man könne trotz einer kritischen Presse kräftig regieren. Auch sprach er sich || S. 64 PDF || gegen das polizeiliche Mittel der Verwarnung und für das gerichtliche Vorgehen aus, d. h. gegebenenfalls Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft. Das war weniger anstößig, objektiver, aber auch unsicherer, weil man den Ausgang eines Prozesses nicht vorhersagen konnte. Eben deshalb bevorzugte Rechberg die unmittelbare Verwarnung. Wie aufgebracht Rechberg war, zeigt der Umstand, daß er, der sonst kaum je korrigierte, eine lange Änderung am Protokoll vornahm. Als die Sache ein paar Tage später im Beisein des Kaisers noch einmal besprochen wurde, meinte Rechberg, seit Wochen rede man von Energie und Strenge gegen die Presse, aber bis jetzt sei noch nichts geschehen. „Die große Masse der Zeitungsleser in Österreich ist für eine so aufregende Kost, wie sie jetzt täglich geboten wird, noch nicht reif.“ Am Ende entschied der Kaiser mit der Mehrheit (nur) für das gerichtliche Einschreiten249.
Eine grundlegende Änderung der bisher doch recht hilflosen Pressepolitik bahnte sich an, als Schmerling die Sache in die Hand nahm. Zu den Vorfällen, die ihn, wie oben ausgeführt, am 11. Jänner 1861 zu einer kleinen inneren Machtergreifung bewogen, gehörte auch die Ernennung des Preßleiters, die ohne ihn vorgenommen worden war250. In der Folge wurde die Leitung der Presse, bemerkenswerterweise ohne Beschluß des Ministerrates, vom Polizeiministerium an das Staatsministerium, also aus der polizeilichen in die politische Sphäre übertragen251. Das Februarpatent stellte dann die Deutschliberalen einigermaßen zufrieden, und die Regierung fand von dieser Seite her mehr Unterstützung. Schmerling ließ es aber dabei nicht bewenden, sondern betrieb eine aktive Pressepolitik durch finanzielle Unterstützung von Zeitungen. Die erste „offiziöse“ Zeitung Schmerlings, wie man dazu sagte, war die „Donau-Zeitung“, später die Zeitung „Der Botschafter“. Damit standen der Regierung – freilich nur in Cisleithanien – wirksame Instrumente der Unterstützung ihrer Politik zu Verfügung252.
Das zweite Thema, auf das hier kurz hingewiesen sei, ist nicht wegen kontroverser Diskussionen interessant, sondern wegen seiner langanhaltenden fundamentalen Bedeutung. Ende Jänner und Anfang Februar wurde nämlich das sogenannte österreichische Protestantenpatent in der Ministerkonferenz beraten und finalisiert, das dann am 8. April 1861 erlassen worden ist. Es hatte mehr Glück als das Patent für Ungarn vom 1. September 1859, das dort weitgehend abgelehnt worden ist253. Das österreichische Patent ist von den Evangelischen angenommen und gefeiert worden. Es habe die Bildung einer Kirche gestattet und endgültig mit allen Benachteiligungen der Evangelischen im öffentlichen || S. 65 PDF || Leben aufgeräumt254, es habe zu einem neuen Aufblühen der Kirche geführt255, ja es ist die Magna Charta der evangelischen Kirche Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses in Österreich genannt worden256. Es erfüllte zwar nicht alle Wünsche der Evangelischen, es wurde später mehrfach abgeändert und weiterentwickelt, dennoch war es im wesentlichen die rechtliche Grundlage dieser Kirchen in Cisleithanien bis zum Ende der Monarchie und teilweise weit darüber hinaus.
Die Notwendigkeit einer derartigen Regelung war längst anerkannt. Schon Kultusminister Thun hatte daran gearbeitet. Im Ministerprogramm vom 21. August 1859 war ein Passus zur Religionsfrage enthalten257. In der Ministerkonferenz war die Sache bereits urgiert worden258. Seit dem 6. Juni 1860 lag dem Kultusministerium ein von den Wiener Konsistorien ausgearbeiteter Gesetzentwurf vor. Die betroffenen und die interessierten Kreise wußten um den Handlungsbedarf in dieser Frage259. Bis zum Jänner 1861 war dennoch nichts Entscheidendes geschehen. Es ist in dieser Frage dem neuen Staatsminister Schmerling zugute zu halten, daß er ohne Verzögerung rasch handelte. Am 9. Jänner 1861 fand ein Gespräch zwischen ihm und dem Unterstaatssekretär Helfert statt, der offensichtlich den Stand der Angelegenheit vortrug. Tags darauf schickte er jedenfalls dem Staatsminister den Konsistorialentwurf „zur gefälligen Benützung für die Ministerkonferenz“260. Bereits am 22. Jänner befaßte sich die Konferenz mit dem Patententwurf261. Die Hauptschwierigkeit lag darin, daß nach dem Oktoberdiplom ein entsprechendes Gesetz nur unter Mitwirkung des Reichrates erlassen werden konnte. Schmerling argumentierte, daß der vorliegende Entwurf nichts anderes als die Hauptgrundsätze enthalte, die längst schon durch allerhöchste Entscheidungen geregelt seien. Es gehe nur um die innere Organisation der Kirche. Alles, was in die Kompetenz des Reichsrates falle, sei herausgenommen. Dazu zählte auch die gesetzliche Regelung der Stellung der Konfessionen untereinander. Eine Debatte darüber schloß ja eventuell eine Konkordatsrevision und damit heftigen Widerstand dagegen ein. Schmerling war sich der Unmöglichkeit bewußt, die Konkordatspolitik vollkommen ändern zu können, und setzte auf einen kleinen Schritt262. In der Tat bestand der Entwurf nur aus 16 Paragraphen. Die geschickte Beschränkung in der momentanen Zielsetzung war also die Voraussetzung, überhaupt etwas zu erreichen. Schmerling stützte sich in der Ministerkonferenz auf eine Koalition seiner deutschliberalen Kollegen und der ungarischen Teilnehmer, die das Patent || S. 16 PDF || entschieden befürworteten263. Es wurden alle möglichen Gründe genannt, jetzt, noch vor dem Zusammentreten des Reichrates, zu handeln: Dringlichkeit, Zweckmäßigkeit, Beruhigung der öffentlichen Meinung, Erzeugung einer günstigen Stimmung in Deutschland. Auch die Einbeziehung Tirols in die Geltung des Patents fand eine Mehrheit. Am 26. Jänner 1861 wurde der Entwurf fertig beraten. Inzwischen hatte Ministerialrat Joseph Andreas Zimmermann, die graue Eminenz in Fragen der Protestanten, bei Helfert seine Meinung zum Entwurf deponiert und Ergänzungen erbeten264. Es gelang dem Unterstaatssekretär in der Ministerkonferenz am 2. Februar, ohne besondere Diskussion nicht weniger als neun neue Paragraphen ins Patent einzufügen265. Zwei weitere Änderungen passierten das inzwischen endgültig in Ministerrat umbenannte Gremium am 9. Februar266. Zusätzlich wurde noch die provisorische Kirchenverfassung vorbereitet, die – analog zu Ungarn – als reine Ministerialverordnung erlassen werden sollte. Mit 17. Februar ist Schmerlings Vortrag über das ganze datiert, am 24. Februar 1861 lag alles dem Kaiser vor267. Nicht einmal sieben Wochen waren seit dem Gespräch Helferts mit Schmerling vergangen. Nun vergingen allerdings wieder Wochen. Am 28. März richteten die Wiener Konsistorien einen Brief an Schmerling mit der dringenden Bitte um Beschleunigung268. Was in diesen Wochen vor sich ging, wissen wir nicht. Am 8. April 1861, sieben Wochen nach dem Vortrag Schmerlings, unterfertigte der Kaiser schließlich das Patent. Bezeichnend ist ein eigenhändiger Zusatz Franz Josephs zum Resolutionsentwurf – ein seltener Vorgang. Schmerling hatte auch beantragt, dem Reichsrat einen Gesetzentwurf über die Regelung der Verhältnisse der evangelischen Kirche zur katholischen Kirche und zu den anderen Konfessionen vorlegen zu dürfen. Der Kaiser dazu: „Dieser Gesetzentwurf ist Mir jedoch früher zur Prüfung zu unterlegen und ist den Bestimmungen des mit dem Römischen Stuhle abgeschlossenen Konkordates, an welchem Ich festzuhalten entschlossen bin, anzupassen“269. Offenbar war es die Befürchtung, mit dem Konkordat in Widerspruch zu geraten, die den Kaiser zögern ließ. Wie auch immer, es war Schmerling und der Regierung gelungen, die Bedenken des Kaisers auszuräumen und den Weg zur Magna Charta der Evangelischen Kirche in Österreich zu bahnen.
Im Kleinen zeigte sich auch in der Pressepolitik und in der Frage des cisleithanischen Protestantenpatents, so wie im Großen in der Verfassungsfrage, daß mit Schmerling mehr als nur ein alter Name neu in die Politik gekommen war. Schmerling bedeutete einen neuen politischen Abschnitt. In Überwindung des absolutistischen Weges der 1850er Jahre || S. 67 PDF || fand die Monarchie mit dem wiederholten Aufgreifen von Vorlagen und Ideen der Zeit von 1848 bis 1850 den Anschluß an die großen Zeitströmungen. Dies geschah nicht schlagartig und nicht vollständig, und durch die Schmerlingsche Ungarnpolitik nicht im ganzen Reich, aber doch kontinuierlich und entschieden. Die gemäßigt Konservativen und die konservativen Föderalisten hatten nach der militärischen Niederlage vom Sommer 1859 zunächst die Mehrheit im Kabinett gestellt. Mit den Ernennungen vom 20. Oktober 1860 und mit der Berufung Schmerlings im Dezember 1860 schwand diese Mehrheit, und mit der Bestellung weiterer Minister am 4. Februar 1861 im Kabinett unter der Leitung Erzherzog Rainers gerieten die Konservativen vollends in die Minderheitenposition. Die folgenden Jahre standen nicht mehr unter dem Signum des Neoabsolutismus, sondern unter jenem des Konstitutionalismus und des erstarkenden Liberalismus.